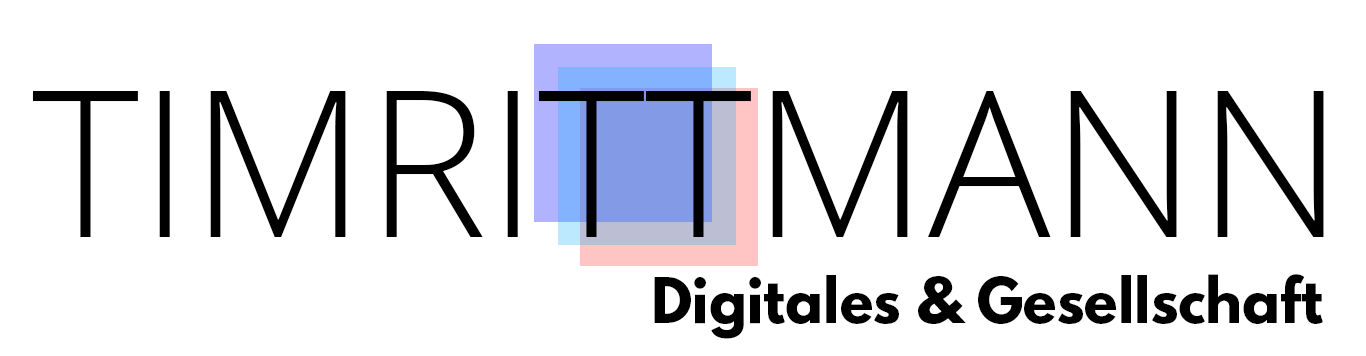Disneys Piratenreihe war nach drei Teilen so sehr verfilzt, es fiel schwer, einzelne Szenen von Palmenstränden und Säbelduellen auf Anhieb einem der Filme zuzuordnen. Immerhin gibt es nun zwei Eselsbrücken: Mit Orlando Bloom und Keira Knightley fehlen im neuesten Teil zwei teure Superstars, die noch in den vorangegangenen drei Teilen das Normalo-Pärchen abgegeben haben.
Das schwankende, lallende Zentrum
Ihre Abstinenz macht den Film nicht schlechter, aber sicherlich preiswerter. Und: „Fremde Gezeiten“, so lautet der Untertitel, ist kein brachiales Bildgewitter wie noch „Fluch der Karibik 3“ und dementsprechend auch der erste Film der Reihe, der weniger gekostet hat als sein Vorgänger. Unter anderen ließ Rob Marshall („Chicago“), der Gore Verbinski auf dem Regiestuhl ablöste, nicht in der Karibik drehen, sondern auf dem günstigeren Hawaii.
Dafür verliert sich „Fremde Gezeiten“ auch nicht in einem Ozean aus langatmigen Seeungeheuerattacken und animierten Piratenbärten. Eine Konstante aber bleibt: Johnny Depp ist wie immer das schwankende und lallende Zentrum des Films. Dass seine Darstellung dem einen oder anderen Disney-Oberen einst als zu schwul und zu bekifft daherkam? Geschenkt. Depp alias Kapitän Jack Sparrow ist das Aushängeschild der Marke. Deren Umsätze gibt Disney stolz mit 2,75 Milliarden Dollar an. Und bei Disney beißt man nicht die Hand, die einen füttert, selbst wenn sie einen Joint zwischen den schwarz lackierten Fingernägeln balanciert.
Pfaue vor der Kamera
Die Geschehnisse finden ihren Anfang in London. Sparrow spricht, in der Verkleidung eines Richters, seinen treuen Maat Gibbs in einem Piratenprozess frei, nur um nach einem spektakulären Fluchtversuch in die Fänge des Königs zu geraten. Denn King George hat Wind davon bekommen, dass die Spanier hinter dem sagenumwobenen Jungbrunnen her sind und will nun Sparrow gegen die katholische Konkurrenz ins Rennen schicken. Zur Seite stehen soll ihm sein alter Feind Kapitän Barbossa, abermals gespielt von Geoffrey Rush.
Anhand der Art und Weise, wie diese drei Figuren – der gefesselte Sparrow, der verweichlichte Fettsack George und der einbeinige Barbossa – aufeinandertreffen, liest sich ab, wie viel Johnny Depp in „Fluch der Karibik“ steckt und wie wenig die Filmreihe ohne ihn wert wäre. Die drei Schauspieler plustern sich auf wie Pfauen, mit Grimassen und rollenden Augen und einer Fülle von Ticks, die man sich ansonsten nur im Stummfilm oder in der Klapse erlauben kann.
Sie wollen sich gegenseitig in Grund und Boden spielen und das tuntige Potenzial ihrer Figuren voll auskosten, weil der Piratenkapitän Jack Sparrow so überkandidelt ist, dass jeder authentische Ausdruck neben ihm sofort erlöschen würde. Das Schauspiel hyperventiliert, und die Szene löst sich dann in einem großartigen Slapstick auf, wobei Jack Sparrow, an einem Kronleuchter in die Freiheit schwingend, einen Windbeutel verdrückt.
Depps Können und Charisma sind dabei höher zu bewerten als die Wahl seiner Rollen in den letzten zehn Jahren. Er muss aufpassen, dass er nicht ausschließlich barfuß und mit faulen Zähnen im Gedächtnis bleibt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch seine Rote-Teppich-Garderobe inzwischen etwas Piratenhaftes. Und natürlich ist die Figur Jack Sparrow, aller Extravaganz zum Trotz, auch nur ein an die Kette der Familienunterhaltung gelegter Abklatsch seines wahren Potenzials. Oder doch nicht?
Schauwerte
Wer in diesen Film geht, um sich kolossale Kämpfe mit Riesenkraken anzuschauen, wird nicht auf seine Kosten kommen. Die einzigen Monster sind zombieähnliche Piraten sowie Meerjungfrauen, die sich zwar als äußerst adrett, aber im Rudel als ebenso tödlich erweisen. Der Film handelt das Wesentliche und Erwartbare schnell und routiniert ab: Alle wollen ewig Leben, alle bekriegen sich gegenseitig, segeln auf skurrilen Piratenschiffen, halb Holz, halb Skelett, durch die Karibik, sie fluchen und saufen und sind ausnahmslos dreckig und eklig. Es besteht ein regelrechter Wettbewerb darin, so hässlich wie möglich zu sein, und das ist wiederum äußerst nett anzuschauen.
Schauwerte bietet dagegen Penelope Cruz als Blackbeards Tochter Angelica. Die Spanierin wirbelt im Gleichschritt mit Depp alias Sparrow durch den Film, und auch Ian McShane als Blackbeard ist ein finsterer Zeitgenosse par excellence. Dass er diese Rollen spielen kann, hat er schon in der HBO-Westernserie „Deadwood“ hinreichend bewiesen. Der Film lebt mehr von seinen Figuren, seinem Tempo (das nur auf offener See ein bisschen stockt) und dem Humor, als von Effekt-Feuerwerken. Keith Richards, der faltige Gitarrist der Rolling Stones, mimt abermals den Piratenpapa Sparrow und erklärt seinem Sohnemann, wo er die Quelle der ewigen Jugend finden kann. Dieser schaut seinem Vater tief ins gegerbte Gesicht und fragt: „Warst du denn schon einmal da?“ Antwort: „Sehe ich so aus?“
Man erwartet ja nicht viel
„Fremden Gezeiten“ erfüllt in nahezu alle Erwartungen. Was einerseits beachtlich ist, bedenkt man, dass es der vierte Teil einer Serie ist, die auf einer Themenpark-Attraktion beruht. Aber man erwartet inzwischen nicht mehr viel, und diese niedrigste aller Erwartungshaltungen, sich nur unterhalten lassen zu wollen und sonst gar nix, wird auf hohem Niveau erfüllt.
Es gibt magische Artefakte, die gesucht werden müssen, so macht man es ja immer, wenn man einer Geschichte ohne viel Aufhebens einen roten Faden geben will: Finde Artefakte X und Y und kehre zurück. Wir kennen das aus Rollenspielen und finden das dann eher nicht so gut. Wie sollen wir dann in einem Film darüber denken? Umso wertvoller ist Johnny Depps mimische Achterbahnfahrt. Da wird auch noch in Zukunft die beste Facial-Expression-Software nicht mithalten können.
Erschienen auf gamona.de