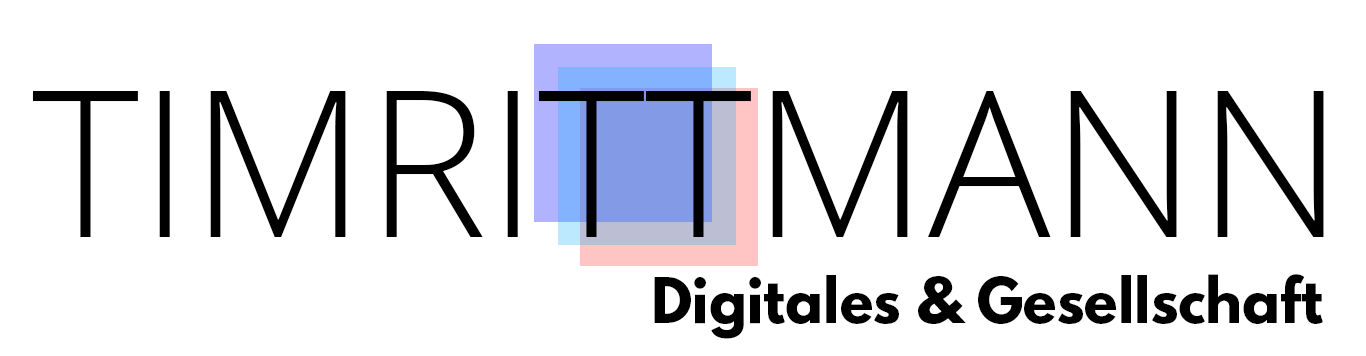Der zweite Weltkrieg war für mich schwarz und weiß. Er bestand aus einem Bild meines Großvaters in Wehrmachtsuniform, es stand bis zu ihrem Tod im Wandschrank meiner Oma. Andere monochrome Bilder kamen später hinzu, aus Geschichtsbüchern und Dokumentarfilmen, sie ergänzten nach und nach mein Bild zu einer Collage. Bilder sind auch Sinnbilder, als Schnappschüsse fassen sie viele Monate und Jahre zusammen. Mal das Leben des eigenen Großvaters, als er noch ein junger Mann war und kämpfen musste. Mal einen ganzen Krieg.
Der spanische Bürgerkrieg ist fast 80 Jahre her, aber viele von uns dürften dieses Foto kennen: Ein republikanischer Soldat prescht nach vorn, sein Gewehr in der Hand. Von einer Kugel plötzlich und tödlich in der Kopf getroffen, wirft es seinen Leib zurück. In dieser Pose des vermeintlichen Heldentods bannte ihn Robert Capa, einer der Pioniere der Kriegsfotografie, auf Fotofilm. Das war 1936. Das Bild ist für die Ewigkeit (auch wenn immer wieder Zweifel an dessen Echtheit angemeldet wurden).
Eine weitere Ikonographie des Krieges zeigt ein weinendes, nacktes Mädchen, das am 6. Juni 1972 einen Napalm-Angriff auf ihr Heimatdorf Trang Bang mit schwersten Verbrennungen überlebte. Der Fotograf: Nick Ut. Das Bild gewann einen Pulitzerpreis und einen World Press Award. Ihm wird nachgesagt, maßgeblich für den Stimmungsumschwung in der amerikanischen Bevölkerung verantwortlich zu sein. So ist auch der „Embedded Journalism“ des jüngsten US-Kriegseinsatz im Irak die Konsequenz aus dem Bildgewitter der vielen freien Fotojournalisten im Vietnamkrieg. Als Kriegspartei steht man ohne moralisches Backup auf verlorenem Posten. Denn ein Kampf, der an der Heimatfront verloren wird, ist letztlich an der Kriegsfront kaum zu gewinnen. Kriegsfotografen wie Capa und Ut funktionierten als Schnittstellen zwischen beiden Fronten.
Eine wahre Geschichte
„The Bang Bang Club“ basiert auf der (wahren) Geschichte von vier weiteren Kriegsfotografen. Greg Marinovich, Kevin Carter, Joao Silva und Ken Oosterbroek haben sich als eingeschworene, risikofreudige Truppe einen Namen gemacht. Gegen Ende des Apartheidregimes halten sie sich in Südafrika auf, um von dem schwelenden Bürgerkrieg zu berichten, der in den Townships von Johannesburg wütet.
1990 befindet sich Nelson Mandela wieder auf freiem Fuß, als Marinovich, noch grün hinter den Ohren, zu den anderen Fotografen stößt. Anfangs aus Sicherheitsgründen, später aus einem Gemeinschaftsgefühl heraus, begeben sie sich in der Gruppe auf die Pirsch nach dem besten Foto. In einen Konflikt, in dem sich Mandelas ANC und die Zulu-Bewegung der Inkatha Freedom Party gegenüberstehen, und der geschätzt 7000 Menschen das Leben kostete.
Der junge Marinovich verdient sich durch Auge und Chuzpe gleich seine Sporen. Für ein Foto erhält er den begehrten Pulitzerpreis. Es zeigt einen Anhänger des ANC, der auf ein brennendes Mitglied der Inkatha Freedom Party einprügelt. Für so einen Schnappschuss – ein Bild, das mehr zeigt als es darstellt – riskieren die Männer viel, nicht selten ihr Leben, und sie verlieren es auch bisweilen.
Neulich wurde der bekannte Kriegsfotograf Tim Hetherington zusammen mit einem weiteren Kollegen in der Stadt Misurata in Libyen bei einem Granatenangriff getötet. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darum um, sagen manche. Dabei dürfte die Motivation bei den wenigsten Kriegsberichterstattern eindeutig zu klären sein. Sicherlich gibt es Idealisten, die an der Front stehen und knipsen und auf ihren Laptops herumhacken, damit die Welt unabhängige Nachrichten erhält. Und nicht die gedrechselten Lügen der einen oder anderen Konfliktpartei. Andere reizt der Nervenkitzel, das Extreme. Gibt es einen extremeren Job, als dem Wahnsinn eines Kriegs nur mit einer Kamera zu begegnen? Vielleicht gehört beides dazu: Idealismus, in die Tat umgesetzt durch Adrenalin und Rücksichtslosigkeit.
Adrenalingeil und innerlich zerissen
„Sie waren mutig und engagiert, aber ich glaube, dass es für sie gleichzeitig auch ein großer Spaß war, vollgepumpt mit Adrenalin vom ständigen Achterbahnfahren“, beschreibt auch Regisseur Steven Silver das Innenleben seiner Protagonisten. Silver ist eigentlich Dokumentarfilmer und hat als Südafrikaner den Bürgerkrieg in Südafrika selbst miterlebt. Berufsethos paart sich mit Nervenkitzel. Man sieht Menschen beim Sterben zu und fragt sich, in einer stillen Stunde, ob man ihnen nicht besser hätte helfen sollen, anstatt sie in Symbole zu verwandeln. Im Dienste der Sache und der Auflage. Es ist ein Konflikt, an dem ein Mensch zugrunde gehen kann.
Neben dieser Geschichte des Erwachsenwerdens, vor deren Schwelle sich die vier Männer noch befinden, ist es ihre Zerrissenheit, die der Film darstellen möchte. Wie sie damit umgehen, nicht aktiv helfen zu können und dann irgendwann merken, dass sie sich diesen zutiefst menschlichen Zug abtrainiert haben, um überhaupt arbeiten zu können. Sie flüchten sich in die Parallelwelt des privaten Glücks, in Drogen oder in ein Rechtfertigungskonstrukt, das sie von aller Schuld befreit.
Wer „War Photographer“, den Dokumentarfilm über James Nachtwey, den derzeit wohl bekanntesten Kriegsfotografen, gesehen hat, findet viele dieser Elemente wieder. Der innere Konflikt vor dem Hintergrund des kriegerischen Konflikts ist die Berufskrankheit der Trigger Happy People. Ihre Aufopferungsbereitschaft paart sich mit Sensationsgier, eine gefährliche Mischung. „The Bang Bang Club“ ist aber kein stilles Psychogramm, nicht das Leiden des jungen Knipsers, sondern ein actionreicher und spannender Film. Diese Gratwanderung ist nicht einfach, gelingt aber.
Das Elend im Allgmeinen
Wie Marinovich gewann auch Kevin Carter, einer der vier Fotografen, mit einem seiner Fotos den Pulitzer-Preis. Wir alle kennen es. Es steht nicht für den Krieg, sondern für das Elend im Allgemeinen. Es ist die Aufnahme eines kleines Mädchens, bis auf die Knochen abgemagert, und einem lauernden Geier. Fotografiert wurde es 1993 im Sudan. Im Anschluss warf man Carter vor, dem Mädchen nicht geholfen zu haben und damit auch nur ein Geier gewesen zu sein. Ein Jahr darauf nahm sich der Fotograf, mit nur 33 Jahren, das Leben. In seinem Abschiedbrief schrieb er: „Lebendige Erinnerungen an Morde und Leichen und Wut und Qual verfolgen mich…an verhungernde und verwundete Kinder, an schießgeile Wahnsinnige, oftmals Polizei, an mordgeile Henker…ich muss los, wenn ich Glück habe, treffe ich Ken.“
Erschienen auf gamona.de