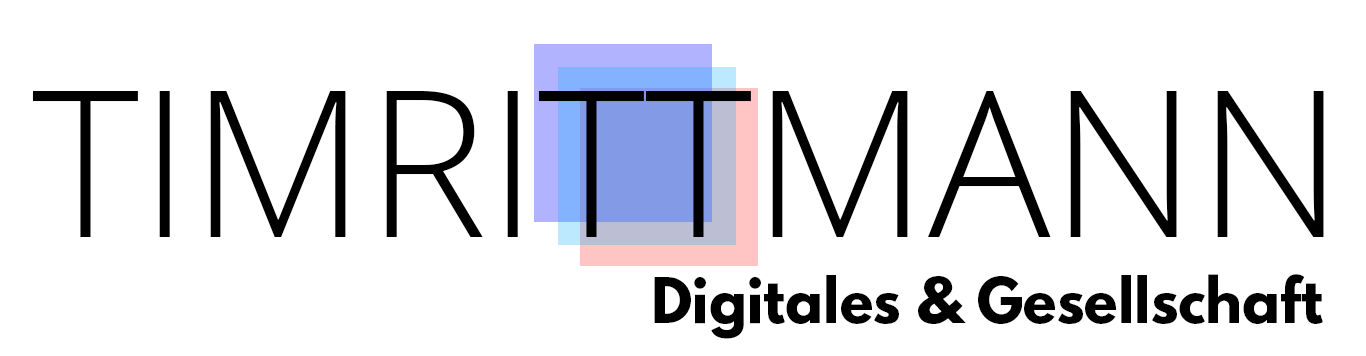Guter Hoffnung
Südafrika ist kein Entwicklungsland mehr. Die Gaming-Szene befindet sich aber noch weitestgehend im Aufbau. Doch langsam regt sich was am Kap – auch dank eines deutschen Festivals.

Der riesige Airbus schaukelt beim Landeanflug auf den O.-R.-Tambo-Flughafen bedenklich. Und doch ist es geradezu beruhigend, die letzten Minuten in der relativen Sicherheit des Flugzeugs zu verbringen. Denn gegen das Gefühl des Ausgeliefertseins im Bauch eines Jumbojets hilft Fatalismus plus Rotwein. ber kaum öffnet sich die hydraulische Tür des Flugzeugs, wartet dort draußen Johannesburg. Eine Stadt, die Angst macht, wenn man zu viel über sie liest. Es wirkt – aus der Ferne betrachtet – geradezu wahnwitzig, dass ein Berliner hier ein Medienkunstfestival aufgezogen hat, dazu mit einem Schwerpunkt auf Indie-Games: die A MAZE. Denn die Stadt hat einen verdammt miesen Ruf.
Für viele Urlauber, die Löwe, Wal und Elefant sehen wollen, ist die Metropole nicht mehr als eine urbane Geschwulst, die um ihren Abreise-Flughafen gewuchert ist. Zum Airport? Einfach der R24 folgen. Nach Johannesburg rein? Lieber nicht. Außerdem hat Südafrika ganz andere Probleme. Nur mal ein Auszug: In den letzten Wochen kamen in Marikana bei Pretoria mehr als 40 Bergarbeiter bei gewalttätigen Auseinandersetzungen ums Leben, pro Jahr zählt das Land knapp 16000 Mordopfer, und die Zahl der HIV-Infizierten liegt bei etwa 11 Prozent. Alles Narben, die der jahrzehntelange Apartheid-Rassismus zurückgelassen hat. Da erscheint die Frage, welchen Stellenwert Computerspiele in der südafrikanischen Gesellschaft besitzen, beinahe unanständig. Doch es lohnt sich, sich von diesen Zahlen nicht abschrecken zu lassen und genauer hinzusehen.
Der Markt und seine Gesetze
Von Rosen überwucherte Gebeine bedecken den linken Arm von Pippa Tshabalala. Die 31-Jährige mit den Tattoos war so etwas wie Afrikas erstes Gamergirl. Noch heute schreibt sie eine Kolumne für das „NAG Magazine“, die einzige ernstzunehmende Computerspiel-Zeitschrift des Landes. Und bis vor vier Monaten war sie Fernsehmoderatorin einer Videospiel-Sendung. Dann wurde ihre Show „The Verge“ eingestellt. Warum, weiß Pippa bis heute nicht. „Viele realisieren gar nicht, wie groß Games hier schon sind“, sagt sie mit erhobener Stimme, um den Typen zu übertönen, der nur ein paar Meter entfernt in seinem Fenster sitzt, Bier trinkt und aus vollem Hals afrikanische Schlager singt.
Pippa zuckt nur mit den Schultern. Sie ist die Vorschau auf ein neues Südafrika. Sie ist weiß, aber mit einem Zulu verheiratet. Sie ist eine Frau, aber zockt leidenschaftlich, und zwar „seit ich ein kleines Mädchen bin“. Sie hat 3D-Animation gelernt und arbeitet jetzt bei MTV Afrika. Letztes Jahr hat sie Thorsten Wiedemann aus Berlin, den Macher der A MAZE, dazu aufgefordert, sein Festival in ihre Heimatstadt Johannesburg zu bringen. Bündnisse wurden geschmiedet, Kooperationen vereinbart, unter anderem mit dem Goethe-Institut vor Ort. Nun sitzt sie auf dem Dach des Alexander Theater im Studentenviertel Braamfontein, wo ein Großteil des Festivals stattfindet, und erklärt, wie hier der Löwe läuft.
„Der Markt folgt in Südafrika seinen eigenen Gesetzen“, sagt Pippa. „Die Playstation 2 etwa verkauft sich immer noch wahnsinnig gut, weil sie so günstig ist.“ Die Regeln des südafrikanischen Marktes sagen, dass Spielen vor allem erschwinglich sein muss. Die betagte Sony-Konsole gibt es neu für unter 1000 Rand, knapp hundert Euro sind das. Aber für Jugendliche aus den ärmeren Vierteln ist das kaum zu stemmen. Vom hochgerüsteten Spielerechner und Next-Gen-Konsolen ganz zu schweigen. PC-Spiele würden sowieso kaum laufen, sagt Pippa, die Internetverbindung sei vielerorts einfach noch zu schlecht, vor allem in Townships wie Soweto.
Dabei ist Township nicht gleich Slum. Es gibt dort ganze Straßenzüge, die auch in deutschen Vororten stehen könnten, mit Familienkutschen in der Garageneinfahrt und grauen Kunststoff-Mülltonnen, die darauf warten, entleert zu werden. Die Kids zocken hier nicht mit Blechdosen Fußball, zumindest nicht nur. Sie lieben auch ihre „Fifa“-Matches, dann spielen die Orlando Pirates gegen die Kaizer Chiefs im kleinen Wohnzimmer der „Matchboxes“ genannten Sozialbauten. Aber ein Onlinezwang, wie er von Blizzard bis Ubisoft inzwischen verlangt wird und Portale wie Steam erst wirklich sinnvoll macht, ist selbst für die schwarzen Mittelklasse-Kids ein Ausschlusskriterium. Wie das erst mit der nachfolgenden Konsolengeneration laufen soll, die den Gerüchten nach viele Dienste verstärkt ins Internet auslagern will, ist allen hier ein Rätsel.
Fünf Stunden Fahrt für Huizinga
Für jemanden, der aus der Township kommt, ist Selbstverwirklichung erst mal zweitrangig. Lucky Nnkosi ist einer der wenigen Schwarzen in Prof. Hanli Geyers Kurs an der Witwatersrand Universität. Es ist der erste Gamedesign-Jahrgang, den das Land je gesehen hat. Eigentlich wollte der 18-Jährige Kampfpilot werden. Oder aber Elektrotechnik studieren. Irgendwas Handfestes jedenfalls, wie viele seiner nicht-weißen Altersgenossen. Doch dann hat er sich für Gamedesign entschieden. Er nennt es Schicksal, oder auch einen Wink Gottes.
Im ersten Jahr ist Spieltheorie angesagt: Huizinga, Salen & Zimmerman, Homo ludens und so weiter. Statt Computerspiele entwickeln die Studenten Brettspiele. Die absoluten Basics sind der Professorin wichtiger. Ihre Studenten sollen lernen, Spielregeln zu erschaffen, die funktionieren und Spaß machen. Lucky ist einer der Besten. Er ist ein freundlicher, aber auch sehr ernsthafter Junge. Deswegen klingt es nicht übertrieben, wenn er behauptet, er sei bereits nach einem Jahr Studium ausgebrannt.
Für den Weg von Soweto zur Uni und zurück braucht Lucky insgesamt fünf Stunden. Jeden Morgen um halb fünf steigt er in einen der ständig hupenden Minibusse, deren Fahrer nur mit Handsignal das Fahrtziel anzeigen. Der Staat bezahlt sein Studium, aber das reicht nicht, weil Luckys Mutter alleinerziehend ist. Der Vater kümmert sich lieber um seine anderen Frauen und deren Kinder. Am zweitägigen Game-Jam, der im Rahmen der A MAZE in den Gebäuden der Universität veranstaltet wird, kann er nicht teilnehmen. Er muss sich um sein zweijähriges Brüderchen kümmern. Auch Ze-Ze, ebenfalls Student aus der 2,5-Millionen- Township, kann sich nur die Aufgabenstellung für den Gamejam abholen. Die restliche Zeit muss er zu Hause bleiben, weil samstags der Transport vom Township ins Studentenviertel Braamfontein doppelt so anstrengend ist. Da ist dann die ganze Stadt auf den Beinen, um Geschäfte zu machen, und der Verkehr ist die Hölle.
Das Thema des Gamejams lautet „Chop Shop“. Es bedeutet, die Einzelteile eines gestohlenes Auto anderweitig zu verwenden. Man könnte auch sagen: das Auto zu remixen. Es erscheint nur logisch: Was repräsentiert eine Stadt wie diese besser als eine Kulturtechnik, deren Ursprung im Autoklau liegt? Doch Johannesburg ist kein Moloch. Die Beklemmung, wenn man aus dem Flugzeug steigt – hervorgerufen durch die Vorstellungen, die Reiseführer und Zeitungsartikel in einem wecken –, weicht einer Aufgeregtheit, die Stadt ein bisschen begreifen zu wollen. Einen Anfang macht, wer nicht nur die Probleme sieht.
So geht es beispielsweise mit der Spielebranche hier seit Kurzem aufwärts, die Studenten an der Witwatersrand sind nur ein Indiz dafür. 2011 verzeichnete der südafrikanische Markt einen bescheidenen Boom. Knapp vier Millionen Spiele gingen über die Ladentheke, nicht miteingerechnet die weit verbreiteten Handyspiele, einfache Programme für einfache Mobiltelefone. Sogar Online-Spiele kommen hier und da auf, weil es inzwischen mancherorts in den reicheren Gegenden zuverlässiges Breitbandinternet gibt. In diesem Jahr ist Südafrika zudem erstmals mit einem Clan bei einem international besetzten „Battlefield 3“-Turnier angetreten. Und mit der Rage Expo hat das Land sogar eine eigene Spielemesse. Zwar sagt Pippa Tshabalala, die meisten Gamer konsumierten Spiele eher wie Actionfilme. Aber es gibt auch das Bedürfnis nach einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Medium. Es fehlte nur die Plattform, eine wie die A MAZE.
Ein bisschen Goldgräberstimmung
Im Keller des Alexander Theaters in Braamfontein hat das Medienkunstfestival Indie-Games zum Anzocken ausgestellt. FreeLives aus Kapstadt haben „Broforce“ dazu gesteuert, einen Koop-Shooter mit Pixelgrafik und sehr realistischem Sound, der als Kontrast zur niedlichen Comic-Gewalt dient. Ein weiteres Spiel aus Südafrika, „Desktop Dungeons“ von den QFC Studios, führt den Spieler durch zufallsgenerierte Verliese. Dort warten Killerziegen und jede Menge schwarzer Humor. Beide Spiele entsprechen den Ansprüchen, die man an Indie-Games hat: Ihre Spielbarkeit leidet nicht unter der Originalität. Aber für Südafrika sind sie nach wie vor etwas Besonderes.
„Wir befinden uns hier im Wilden Westen des Gamedesigns, und wir sind die Pioniere“, erklärt Evan Greenwood von FreeLives und meint damit, dass er nahezu mit jedem Schritt Neuland betritt. Greenwood und sein Kollege Rodain Joubert von QFC sehen aus wie klassische Nerds, der eine bebrillt, der andere mit Kinnbart und halblangen Haaren. Und beide sind weiß. Über eine Antwort auf die Frage, wie viele schwarze Kollegen sie kennen, müssen sie lange nachdenken: „Zwei, vielleicht drei. Wer das Privileg genossen hat, mit Computerspielen aufzuwachsen, hat entweder von der Apartheid direkt profitiert oder wurde zumindest nicht von ihr unterdrückt“, sagt Rodain.
Mit Anfang dreißig gehören beide zu den alten Hasen der Branche. Zwar gab es bereits 1996 mit „Toxic Bunny“ ein Spiel aus Südafrika, das weltweit wahrgenommen wurde. Viel mehr, als ein HD-Remake ihres einzigen Mini-Erfolgs anzukündigen, haben dessen Macher Celestial Games aber nicht mehr hinbekommen. Das derzeit einzige erfolgreiche Studio des Landes ist Luma Arcade aus Johannesburg. Dort bastelt man gerade an „Bladeslinger“, einem Vorzeigespiel für das iPad. „Südafrika ist ansonsten zu weit weg und isoliert. Wir fühlen uns mit unseren eigenen Spielen oft sehr unsicher, weil es so wenige Leute gibt, die professionelles Feedback geben können“, so Rodain. Trotzdem herrscht ein bisschen Goldgräberstimmung in der Stadt, die einst durch die nahen Goldminen groß geworden ist.
Gerade einmal 24 Stunden ist es her, da wohnten Rodain und Evan einem historischen Moment bei: der Gründungssitzung von Making Games South Africa, der ersten Vereinigung von Gamedevelopern des Landes. Es geht darum, sich besser zu vernetzen, sich der Politik als Zukunftsindustrie zu präsentieren und neue Ideen anzubieten. „Man müsste die Entwicklung von Videospielen mehr in den Schulalltag integrieren. Denn Computerkenntnisse sind unheimlich wichtig“, findet Rodain. „Es ist eine dämliche Idee, ein Kind vor einen Rechner zu setzen und zu sagen: Jetzt lernen wir Tabellenkalkulation. Gib ihm stattdessen ein simples Game-Development- Werkzeug und sag, es solle etwas bauen, das Spaß macht.“
Ist es also angebracht, sich in der Stadt des Chop Shop mit Computerspielen zu beschäftigen? Es scheint, als wäre es fahrlässig, es nicht zu tun.