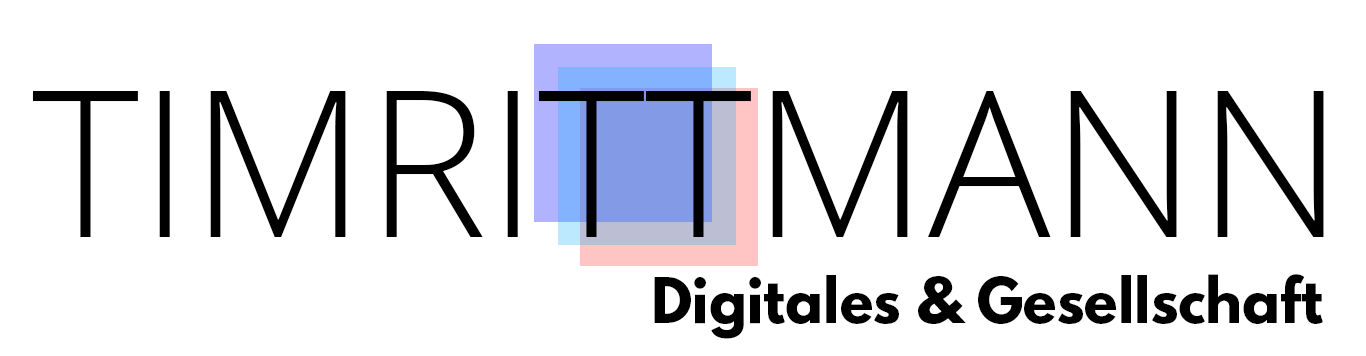Der Horror, der Horror, der Horror!
„Alien: Isolation“ ist das aufregendste Computerspiel seit langem. Gegen den übermächtigen Gegner helfen keine Waffen. Nur die Flucht.

Nicht alle Computerspiele wollen unsere Freunde sein. Alien: Isolation, ein Survival-Horror-Spiel von Sega und Creative Assembly, ist in vielerlei Hinsicht so genial wie sadistisch, weil es den Spieler in permanente Angst versetzt. Selbst die einst sicheren Lade – und Optionsmenüs bieten keine Zuflucht mehr. Als ob man in einem zwanzigstündigen Gruselfilm die Hauptrolle spielt und weder auf Stopp drücken, noch die Hände vors Gesicht schlagen oder vorspulen kann. Der reinste Horror.
Als Spieler betrachtet man die Welt aus Amanda Ripleys Augen. Sie ist die Tochter jener Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, die 1979 in Ridley Scotts Film Alien dem ersten schwarzen Weltraummonster im weißen Schlüpfer entgegentrat. Auf der Suche nach Lebenszeichen ihrer Mutter verschlägt es Amanda auf die Weltraumstation Sevastopol. Dort lauert der Xenomorph, das vom Schweizer Künstler H.R. Giger geschaffene Alien mit dem Doppelkiefer.
Gewalt ist keine Lösung
Alien: Isolation zwingt einen zum radikalen Umdenken. Es gibt keine Unzahl monströser Gegner, die mit futuristischen Waffen niedermacht werden. Wozu auch? Ein einziges Monster reicht vollkommen aus. Und trotz Egoperspektive, die übrigens ohne grafische Spielinformationen im Head Up Display auskommt, ist das Spiel beileibe kein Egoshooter, eher ein Versteckspiel. Feuergefechte mit den wenigen Überlebenden der Station oder der Androiden-Polizei locken das Alien an, und weder Revolver noch Flammenwerfer können es wirklich beeindrucken. Der sonst allmächtige Spieler ist plötzlich ziemlich wehrlos, der Fluchtreflex ersetzt die „trigger happiness“, der Horror liegt im Ausgeliefertsein.
Die Raumstation Sevastopol ist ein schwach beleuchtetes, mehrstöckiges Wirrwarr aus Korridoren und Lüftungsschächten, verwüsteten Arbeits- und Aufenthaltsräumen. Die Angst lauert hinter jeder Ecke, jeder Tür, jeder Boden- und Deckenluke, die Ripley öffnet. Es dauert einige Zeit, bis man erstmals auf das Alien trifft, aber eine Paranoia macht sich von der ersten Sekunde an breit. Jedes Ereignis wirft seine Schatten voraus, und auf Sevastopol tanzen die Schatten um den Spieler herum. Der Horror liegt in der Vorahnung.
Ruhe bitte
Noch subtiler ist die Geräuschkulisse. Bereits das mechanische Klicken der retrofuturistischen Gerätschaften erinnert an die kehligen Laute des Aliens. Die Musik, selten mehr als ein bedrohlicher Unterton, unterstützt das allgemeine Unwohlsein. Bereits das Öffnen einer Tür erzeugt einen Höllenlärm, und das Alien jagt vor allem nach Gehör. Das kann sich Amanda zunutze machen, indem sie mit selbst gebastelten Knallbomben von sich ablenkt und das Alien auf die wenigen marodierenden Plünderer und Androiden hetzt.
Nimmt der Spieler verdächtige Geräusche wahr, und die gibt es eigentlich immer, sollte er das aus dem Film bekannte Ortungsgerät benutzen, eine Art piependen Geigerzähler, der immer wieder kurz gezückt wird. Nähert sich ein Feind, erscheint ein Punkt auf dem Display. Angezeigt wird jedoch bloß die absolute Distanz in einem frontalen 90-Grad-Winkel, aber nicht die relative Position. Befindet sich das Alien über einem und gleitet eklig aus einer Luke herab, heißt es Reißaus nehmen. Falls es dann nicht schon zu spät ist.
Das Alien selbst ist unberechenbar. Die künstliche Intelligenz des Computergegners schreitet keine vorprogrammierten Wege ab, wie man es aus Metal Gear Solid oder Batman: Arkham City kennt, sondern bewegt sich frei durch die Station, angelockt von allerlei Geräuschen. Selbst offene Türen und Luken nimmt es wahr und sucht dann manisch nach der Beute. Der Spieler verbirgt sich unter Tischen und Kisten, und falls man eine Konsole mit Kamera besitzt, kann man auf dem Sofa sitzend den Kopf nach links und rechts bewegen, die Bewegungen werden registriert und in das Spiel übertragen. So lugt Ripley hinter Ecken und Tischkanten hervor.
Der Horror nutzt sich ab
Das Standard-Versteck sind jedoch die überall auf der Station verteilten Spinde. Manchmal verharrt man eine halbe Ewigkeit darin, blickt durch ein kleines vergittertes Sichtfenster und lauscht angestrengt. Den piependen Geigerzähler auspacken oder vergessen, per Knopfdruck die Luft anzuhalten, hieße, das Alien anzulocken. Dann wäre man wieder einmal tot. Man stirbt übrigens ziemlich oft.
Der Spielstand wird deswegen möglichst häufig gespeichert – die einzig wirksame Vorsichtsmaßnahme. Ein Autosave ist nicht vorgesehen. Amanda sucht stattdessen auf der Sewastopol verteilte Speicherstationen, steckt eine Art Diskette in ein tickendes Lesegerät. Und wartet. Wollen Sie den Spielstand speichern? NEIN. JA. Wieder warten und hoffen, dass sich das Alien nicht ausgerechnet jetzt von hinten anschleicht und jeden ungesicherten Fortschritt zunichte macht. Hardcore-Gamer lieben diese kleinen Gemeinheiten, zumindest in der Theorie. In der Praxis sind solche Momente (und sie passieren) unendlich frustrierend. Doch irgendwann wird das Ableben mit einem Achselzucken quittiert, die Flucht in den Spind zur lästigen Alltagshandlung, das Spiel verliert sich ein wenig in der Repetition. Der Horror, der Horror, der Horror – er nutzt sich irgendwann ab.