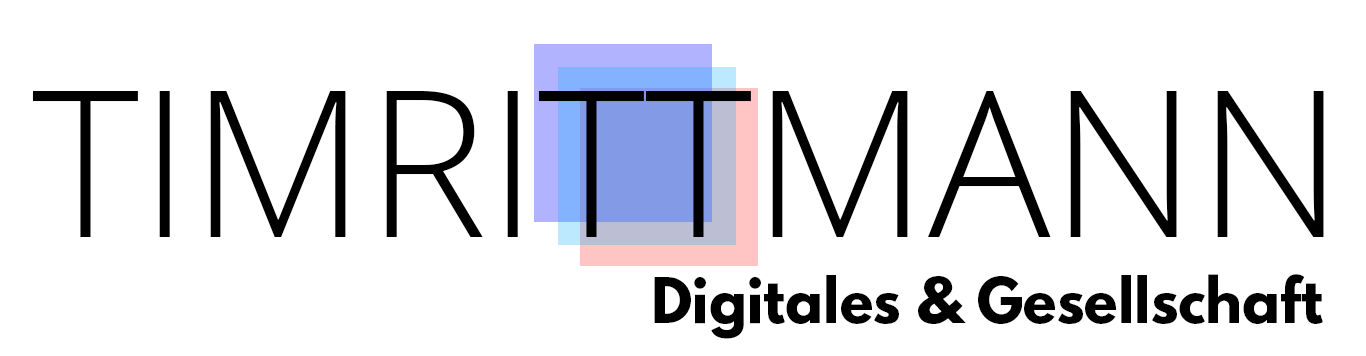Hier Münze einwerfen
Im Frühjahr veröffentlicht Electronic Arts ein Spiel mit Signalwirkung. „Battlefield Heroes“ ist gratis – könnte aber viel Geld einbringen und Videospiele für immer verändern. Das Magazin GEE analysiert das Zukunftsmodell „digitale Distribution“.

„Alle Zeichen stehen auf Wachstum“: Diese Prognose stammt nicht aus der Zeit vor der Weltwirtschaftskrise, sie steht aktuell in einer Presseerklärung aus Karlsruhe. Dort sitzt Gameforge, ein mittelständischer Betrieb, und der kündigt darin an, 200 Mitarbeiter einstellen zu wollen: Grafiker, Programmierer, Systemadministratoren und Assistenten der Geschäftsleitung. Denn die Geschäfte gehen gut.
Gameforge vertreibt fast ausschließlich Browsergames, die „Gladiatus“ heißen und „OGame„. Dabei handelt es sich nicht um Casual Games, sondern um Strategie- oder Online-Rollenspiele. Ihre Namen tauchen kaum in Hitlisten auf, dafür aber auf einer Menge Werbebanner im Internet. Sie werden von vielen Hardcore-Gamern belächelt und trotzdem von Millionen Menschen gespielt. Sie sind im Prinzip kostenlos – „Free2Play“ heißt das Modell -, sie laufen auf jedem noch so alten Rechner und finanzieren sich ausschließlich durch „Downloadable Content“ (DLC), den Verkauf von virtuellen Gegenständen zu winzigen Beträgen. Der Spieler kann für echtes Geld Items erwerben, die sein Spiel persönlicher machen oder mehr Erfolg versprechen.
Und dieses sogenannte Micropayment ist gerade in Zeiten der Krise ein Erfolgsfaktor. Schließlich sind große Spiele immer auch teure Spiele, die Games aus Karlsruhe hingegen kosten nur so viel, wie der Spieler will. Sie sind also immer ihren Preis wert. Die Folge: Gameforge wächst, während die großen Videospielhersteller mit Verkaufsrückgängen und Arbeitsplatzeinbußen zu kämpfen haben.
Selbst beim Branchenriesen Electronic Arts stehen nicht mehr wie früher alle Zeichen auf Wachstum, weswegen der Konzern nun reagiert und in diesem Frühjahr den Shooter „Battlefield: Heroes“ auf den Markt bringen wird, kostenlos und natürlich inklusive „Downloadable Content“. Es ist nur ein Testballon. Aber wenn er weit fliegt, werden ihm andere folgen.
2. Teil: Der geschenkte Gaul
Eigentlich hat die „Battlefield“-Reihe nicht den nötigen Massen-Appeal, um auf dem Markt der kostenlosen Spiele bestehen zu können. „Battlefield 1942“ ist zwar ein beliebter Online-Shooter, gilt aber als zu kompliziert und wenig einsteigerfreundlich. Deswegen hat der schwedische Entwickler DICE „Battlefield: Heroes“ entsprechend umgerüstet. Die Weltkriegskulisse ist nun comichaft überzeichnet und erinnert stark an Valves „Team Fortress 2“, die Anforderungen an die Hardware sind minimal. DICE muss schließlich vor allem jene Leute erreichen, die sich nicht jedes Jahr eine neue Grafikkarte anschaffen. So lautete jedenfalls das Ziel, das EA-Boss John Riccitiello vorgegeben hat, als er im vorigen Jahr den Posten des Geschäftsführers übernahm: neue Wege finden, mit neuen Spielen neue Käuferschichten erreichen zu können.
Simpel genug ist die Spielmechanik von „Battlefield: Heroes“: Zwei Teams kämpfen gegeneinander. Auf der einen Seite die an die Alliierten erinnernde Royal Army. Auf der anderen die National Army, die nach dem Vorbild der Truppen Nazideutschlands gestaltet wurde. Es gibt nur drei Basis-Charakterklassen, die sich auf einer Hand voll Schlachtfelder gegenseitig bekämpfen sollen. Dabei ist die Kamera stets hinter dem Charakter positioniert – und das nicht ohne Grund. Der Spieler soll sein virtuelles Hab und Gut stets im Blick haben: den lustigen Hut, den schicken Ledermantel, die neue Frisur oder die Tanzanimation. Denn das sind die kleinen Dinge, die er sich für ein oder zwei Euro im Shop geleistet hat – und die Electronic Arts sehr viel Geld einbringen sollen, ohne dabei den Solarplexus eines jeden Online-Spiels zu treffen: die Fairness des Games, seine Balance. Zur Ankündigung des Spiels erklärte DICE-Chefentwickler Ben Cousins: „Wir wollen auf keinen Fall Gegenstände verkaufen, die in das Gameplay eingreifen. Man kann sich keine Wunderwaffen kaufen, die einem einen Vorteil im Kampf geben.“ Wobei es dann natürlich nur billig ist, zu fragen, wer bereit sein soll, für Nippes zu zahlen, nur um einen hübschen Comicsoldaten aufs Schlachtfeld zu führen.
Klaas Kersting glaubt zu wissen, wer die Zielgruppe für virtuelle Gegenstände ist und was sie will. Der Geschäftsführer von Gameforge geht nicht davon aus, dass Hardcore-Gamer ihn reich machen werden – dafür aber andere: „Es gibt geschätzte zwei Milliarden PC-Besitzer“, rechnet er vor, „und bis zu 60 Prozent derjenigen, die online sind, wollen auch online spielen.“ Nach eigenen Angaben spielen in Europa und Asien mittlerweile 15 Millionen Menschen von Gameforge vertriebene oder entwickelte Spiele. Das in Korea erschaffene „Metin2“ etwa ist ein Online-Rollenspiel vom Schlage „World Of Warcraft“. Das Setting ist der Orient, die Spieler organisieren sich in Gilden und ziehen auf Pferden reitend und säbelschwingend gegen Monster oder andere Spieler in die Schlacht. „Metin2“ sieht zwar längst nicht so gut aus wie ein herkömmliches PC- oder Konsolenspiel, ist inhaltlich eher eintönig und besitzt so gut wie keinen Kundensupport – aber einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und das macht die Masse der Spieler auch nicht.
Denn 90 Prozent nehmen das „Free2Play“ wörtlich und zahlen niemals auch nur einen Cent. Die anderen zehn Prozent aber haben es in sich. Sie geben meist kleine Beträge aus: ein paar Euro für eine Waffe oder einen Trank, der die Erfahrungspunkte verdoppelt. Ein paar Euro mehr für ein gutes Reittier, das die Reisezeiten im Spiel enorm verkürzt und auch im Kampf von Nutzen ist. Kleinvieh macht auch Mist. Einzelne Spieler investieren in ihre Spielfigur sogar abstrus viel Geld. Erst kürzlich stellte ein 45-jähriger „Metin2“-Spieler aus Bochum Strafanzeige gegen unbekannt, weil sein Spielaccount geplündert wurde. Virtuelle Gegenstände im Wert von angeblich 1000 Euro seien verschwunden.
3. Teil: Die Katze im Sack
Es geht den Herstellern nicht nur darum, Profit zu machen. „Downloadable Content“ soll die Produktionskosten einspielen und das Spiel selbst am Laufen halten: „Wenn man ein Spiel nicht einfach nur in den Laden stellen, sondern es auch weiterentwickeln will, muss man das irgendwie finanzieren“, sagt Volker Wertich, der einst maßgeblich am Entstehen der „Siedler“-Reihe beteiligt war. Nun ist er Geschäftsführer des Entwicklers Phenomic und arbeitet am Projekt „Battle Forge„, einem Strategiespiel mit Kartensets, das vor allem online gespielt werden soll.
Der Clou an „Battle Forge“ besteht darin, dass der Spieler seine Truppen nicht Session für Session neu rekrutieren muss, indem er eine Kaserne baut und darin seine Soldaten ausbildet. Diese stehen ihm in Form von Spielkarten auf einem virtuellen Kartendeck bereits zur Verfügung, und zwar pro Karte eine Einheit. Die Karten gleichen den Fußballbildchen in Panini-Sammelalben: Es gibt wahnsinnig viele davon, und manche sind mehr wert als andere. Deswegen werden sich die Spieler neue Kartensets holen. Gegen ein kleines Entgelt, versteht sich. Allerdings wissen sie vorher nicht, welche Karten im erstandenen Set enthalten sind. Sie kaufen quasi die Katze im Sack und benutzen eine Tauschbörse, um sie bei Nichtgefallen wieder loszuwerden. Das macht „Battle Forge“ zweifelsohne zu einem interessanten Modell: Es ist ein Spiel, das nicht nur den Ehrgeiz der Spieler anstacheln will, sondern auch ihre Sammelleidenschaft, um dann daraus Profit zu ziehen.
Die Hersteller folgen derzeit so ziemlich jedem Pfad, um ihr Geschäft wieder zum Laufen zu bringen. Sollten „Battle Forge“ oder „Battlefield Heroes“ erfolgreich sein, werden andere Titel folgen. Schließlich geht es um Gewinnmaximierung, Ausgabenminimierung und darum, an einem Spiel möglichst über Jahre hinweg immer wieder zu verdienen – ähnlich wie Hollywood mit einem Kinofilm. Und so könnte am Ende einer potentiellen Erfolgsgeschichte von „Downloadable Content“ viel mehr verschwunden sein als das traditionelle, vollständig zu erwerbende Game – nämlich seine Verpackung, das Manual, die DVD oder Blu-ray, kurz: alles Materielle. Denn auf Datenträger und Papier zu verzichten und ein Spiel stattdessen gänzlich digital zu vertreiben spart nicht nur Lagerkosten. Auch die Verkaufsmarge des Einzelhandels könnte aus der Rechnung gestrichen werden. Wenn also immer mehr Spiele komplett über das Internet vertrieben würden, müssten Elektrofachgeschäfte ihren Entertainmentbereich großflächig umgestalten. Sammler werden nach und nach auf immer mehr Objekte der Begierde verzichten müssen und Ketten wie Gamestop den Weg alles Irdischen gehen.
Wenn also die Profite größer werden, weil die Unkosten schrumpfen, könnte das positive Effekte für den Verbraucher, sprich den Gamer haben. Oder sollte es zumindest. Denn eine Frage steht im Raum: Was passiert mit dem Mehr an Moneten? Werden die Spiele billiger? Wird das Geld genutzt, um sie besser zu machen, weil größere Teams länger daran arbeiten können? Wird der Kundensupport qualitativ hochwertiger? Wenn nichts dergleichen geschieht, wird sich nämlich ein Mehr an Kunden fragen, warum sie Geld für überteuerte Produkte ausgeben sollen, denen es häufiger an Innovationen denn an technischen Unzulänglichkeiten mangelt.
4. Teil: Der Wolf im Schafspelz
Ob es auch wirklich so kommen wird, weiß derzeit noch niemand. Was sich nämlich nach einer Patentlösung anhört und in Asien inzwischen das gängige Modell zur Refinanzierung eines Computerspiels ist, stößt in Europa und den USA noch auf heftigen Widerstand. Und gerade Electronic Arts und das Entwicklungsstudio DICE, die mit dem Cartoon-Kriegern von „Battlefield: Heroes“ ganz oben auf der Welle schwimmen wollen, sind daran nicht unschuldig: Vor einem Jahr wurde „Battlefield: Bad Company“ veröffentlicht und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit und guter Kritiken – abgesehen von der Einschränkung, mit nur fünf Waffen in den Kampf ziehen zu dürfen. Weitere fünf waren zwar schon auf den im Handel erhältlichen Datenträger vorhanden, mussten aber gegen eine kleine Summe freigeschaltet werden. Das sahen einige Spieler nicht ein, hatten sie doch den vollen Preis bezahlt. Und nun sollten sie noch mal zahlen? Für etwas, das sich bereits in ihrem Besitz befand? Auch zusätzliche Episoden für Spiele wie „Fable 2″ oder “ Fallout 3″, die gegen knapp zehn Euro über die jeweiligen Onlinenetzwerke der Konsolen zu beziehen sind, werden deswegen seitdem kritisch beäugt.
Volker Wertich sieht das Positive: „Gerade für Gamedesigner brechen mit ‚Free2Play‘ sehr spannende Zeiten an“, prognostiziert er. Und das gerade, weil Spieler sich ein Produkt lange werden anschauen können, bevor sie sich entscheiden, Geld auszugeben. Es soll also seltener vorkommen, dass sich mittelmäßige Spiele allein durch eine gut geschmierte Marketingmaschinerie massenhaft verkaufen. „Es wird wieder mehr auf das Spiel ankommen. Schließlich muss der Spieler einen interessanten Spielmechanismus vorfindet, der ihn bei der Stange hält.“ „DLC“ bedeutet also auch, dass Spieler in Zukunft vermehrt Games kostenlos anspielen können, aber nur gegen Bares voll auskosten dürfen. Die Beispiele dafür mehren sich: In Südkorea etwa wurde 2006 eine kostenfreie Version des Fußballspiels „Fifa“ veröffentlicht. Nur für spezielle Fähigkeiten, etwa einen Turbo-Boost oder dekorative Items wie Trikots, müssen die Spieler zahlen. Fünf Millionen koreanische User spülen so monatlich rund eine Million Dollar in die Kassen von EA. Solch ein Modell wäre für viele Sportspiele als Alternative zum herkömmlichen Vertrieb durchaus auch in Europa und den USA denkbar.
Die Spieler werden sich wohl damit anfreunden müssen, scheibchenweise für Spiele zu bezahlen, die unter dem Label „Free2Play“ laufen. Wenn alles gut läuft, profitieren sie davon: Sie geben im gesunden Maß Geld für ihr Hobby aus und bekommen ein optimal auf sie zurechtgeschnittenes Spielerlebnis. Sie können die Produkte ausführlich testen, bevor sie sich zum Kauf entschließen. Zudem könnten die übrig gebliebenen Vollpreisspiele günstiger werden, weil Vertriebskosten wegfallen. Dass „DLC“-Spiele durchaus mit großen Games mithalten können, zeigt das aktuelle „GTA IV“-Add-on „The Lost and Damned“.
Ein weiteres Argument ergibt sich aus dem bislang eher knapp kalkulierten Produktionsablauf: Viele Ideen und Inhalte können derzeit in einem Titel nicht untergebracht werden. Hat das Kreativteam richtig Fahrt aufgenommen und sich mit der entworfenen Szenerie vertraut gemacht, schiebt meist der Businessplan den Release-Termin vor eine inhaltliche Optimierung des Spiels. Oft wird dann nur noch technisch verbessert, und dann geht es ins Regal. Oder eben bald auch nicht mehr ins Regal. Eines aber steht jetzt schon fest: Spieler müssen mehr denn je auf-passen, wofür sie ihr Geld ausgeben.
Denn Geld ist das, worum es den Firmen geht. Und da bald vielleicht nur noch für das bezahlt werden muss, das es wert ist, bezahlt zu werden, wird Geld mehr denn je zur Geheimwaffe der Spieler, mit der sie Zukunft ihres Hobbys gestalten können.
Erschienen in GEE April 2009 und Spiegel Online, 23.März 2009