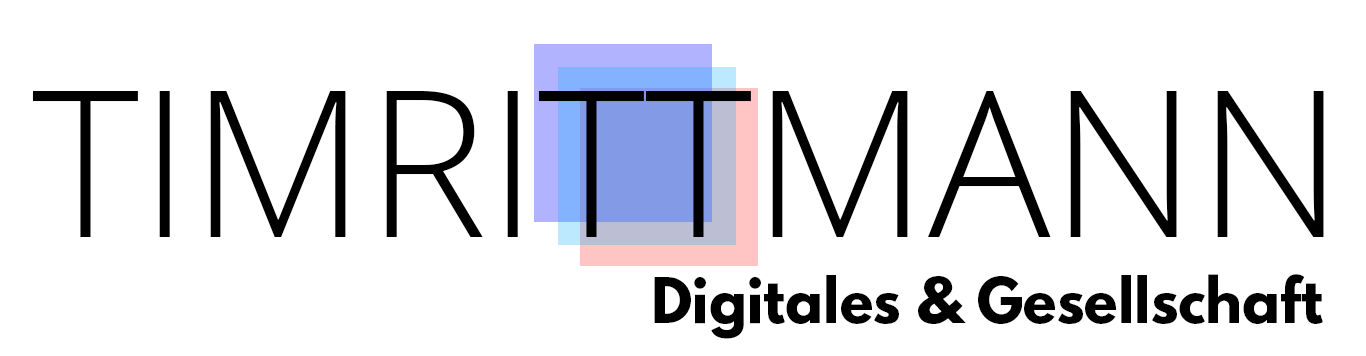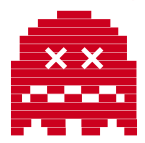Sind Videospiele harmlos oder eine ernste Gefahr? Darüber wird derzeit heftig gestritten – im Bundestag und am Küchentisch. Doch warum spalten gerade Spiele die Gesellschaft? Die Analyse eines von Angst getriebenen Konflikts
Mozart, Schiller, Goethe: Es sind die Vertreter des klassischen Kulturkanons, nach denen die Veranstaltungsräume der Stuttgarter Liederhalle benannt sind. Im Beethoven-Saal spielt an diesem Abend das Symphonieorchester des Südwestrundfunks Werke von Ravel für Gitarre. Etwas ganz anders hätte eigentlich zur selben Zeit im benachbarten Hegel-Saal zu hören sein sollen: Pfiffe, Trampeln und Applaus von 1500 Menschen, begleitet von knatterndem Gewehrfeuer.
Die Bundesliga ist ausgefallen
Die „Intel Friday Night“ hatte sich angekündigt, die Bundesliga der Computerspieler. Vielleicht wären sich Klassikfans und Computerkids im Gebäude begegnet, hätten sich misstrauisch beäugt, dann aber eventuell ein Gespräch angefangen. Doch aus dem Hegel-Saal war kein Mucks zu hören. Denn der Clash der Kulturen war abgesagt worden – und damit die symbolische Chance auf Annäherung.
Denn eine Standard-Disziplin des E-Sport-Wettbewerbs ist „Counter-Strike“, das „Killerspiel“ überhaupt – und da die Liederhalle nur 20 Kilometer entfernt liegt von der Kreisstadt Winnenden, erklärte Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (CDU), man könne „angesichts des schrecklichen Amoklaufs, bei dem 15 Menschen getötet wurden“ eine solche Veranstaltung nicht akzeptieren. Eine Veranstaltung, bei der Hunderte junger Menschen andere junge Menschen umjubeln, die eins besonders gut können: am Rechner ballern. Schuster konnte sich sicher sein: Kaum jemand außer ein paar enttäuschten Computerspielern würde seine kurzfristige Absage kritisieren.
Ein Werther des Digitalen
Ein digitaler Graben spaltet die Gesellschaft entlang einer Altersgrenze, die zwischen Ende dreißig und Anfang fünfzig verläuft. In diesem Graben findet sie statt, die Killerspieldebatte. Sie tobt seit Jahren und kommt seit Jahren nicht vom Fleck. Zeigefinger erheben sich in alle Richtungen, Köpfe nicken
heftig im Takt gegenseitiger Schuldzuweisungen.
Die Diskussion wird so erhitzt geführt, weil es um mehr geht als um Ursachen von Gewalt: Viele Gegner treibt ein kulturelles Unbehagen gegen Computerspiele im Allgemeinen. Sie bekommen Angst bei Fernsehbildern, die blutbefleckte Gänge und grelles Mündungsfeuer zeigen, das Kindergesichter erleuchtet – und lehnen daraufhin das Medium in Gänze ab.
Diese Reaktionen sind nicht neu, sie sind Teil der Evolution aller neuen medialen Ausdrucksformen. Sie sind immer zu beobachten, wenn Medien (meist dank Gewaltdarstellungen) zu Massenphänomenen heranwachsen, es gab sie bei der Emanzipation des Films, des Comics und des Buchs – selbst Goethe wurde vorgeworfen, seine „Leiden des jungen Werther“ würden Jugendliche zum Selbstmord verführen.
Bei Videospielen stürzen und stützen sich die Gegner des Mediums auf Ausnahmesituationen wie die Tragödie von Winnenden. In solchen Momenten tritt der Kampf Alt gegen Jung und Etabliert gegen Neu ins Licht der Öffentlichkeit – doch kaum jemand benennt, um was es dabei wirklich geht.
Herrscher der Technologie
„Es geht bei diesem Konflikt nicht nur um das Verhältnis von Eltern und Kindern, sondern auch um Technologien und ihre Beherrschung“ sagt der Kulturwissenschaftler Joseph Vogl von der Berliner Humboldt-Universität: „Jugendliche sind im Besitz eines technologischen Wissens um Kommunikationsformen, das sich absetzt von der Brief- und Schriftkultur der Eltern, aber auch von den bisher geläufigen Massenmedien. Plötzlich ist der Wissensvorsprung der Älteren dahin, und damit ihr jahrhundertealtes Selbstverständnis – dass sie, die Erwachsenen, den Kindern etwas beibringen. Das verstärkt das Misstrauen gegenüber Computerspielen. Die lärmenden, schillernden und manchmal auch bluttriefenden Lustgärten des digitalen Wandels werden von jenen verteufelt, die keine Eintrittkarte lösen können oder wollen.
Würden dieselben Bilder im Fernsehen laufen, die Befremdung wäre nicht so groß. Die erfolgreiche amerikanische Fernsehserie „CSI“ zum Beispiel ist nicht zimperlich mit Gewaltdarstellungen, zeigt zur besten Sendezeit schlimm zugerichtete menschliche Körper und löst doch keine Proteststürme aus. Das Fernsehen hat sich als einlullender und passiv zu konsumierender Freund erwiesen.
Die große Unbekannte des neuen Mediums Computerspiel ist zudem seine Interaktivität. Ihretwegen hat der Wissenschaftler Jesper Juul Videospiele unlängst als emotionalstes aller Medien bezeichnet. Er wollte damit seine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Unbewusst hat er jedoch die Angst vieler Menschen ausgesprochen – denn selbst wenn die Kugeln nur virtuell fliegen, der Zeigefinger zuckt dennoch ganz real.
Sehnsucht nach Vorbildern
Wolfgang Bergmanns sonst so unaufgeregte Stimme klingt heiser, seine Stimmbänder sind zu sehr strapaziert worden in den vergangenen Wochen. Seit Langem setzt sich der Kinderpsychologe mit dem Thema „Kind und Computer“ auseinander. Das machte ihn „nach Winnenden“ begehrt in Fernsehmagazinen und -talkshows. Er saß mit Günther Jauch in Sofarunden und gab Zeitungs- und Radiointerviews, um in wenigen Worten zu sagen, was sonst Bücher füllt.
Er erzählt von seinem Alltag in der Praxis, von der zunehmenden Anzahl von Computerspielsüchtigen und von der gefährlichen Anziehungskraft von „World Of Warcraft“, von virtuellen Gemeinschaften, die „Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit einfordern und lehren“ und dabei einen Konflikt mit dem Alltag heraufbeschwören.
„Diese digitalen Bilder wachsen tief in die Tagträume und Selbstbilder der Jugendlichen hinein, wie es das nie zuvor gegeben hat“, sagt er und zitiert den „Sims“-Erfinder Will Wright: „Kinder spielen den Traum der kleinen Götter.“ Er meint damit, dass Kinder in Spielen so vieles erschaffen, aber vor allem auch zerstören können. So wie Götter einen Blitz auf die Erde schleudern. Die Spiele wirken auf Kinder und Jugendliche, weil sie fantastisch sind – und gewalttätig. Sie können sich in Konflikten erproben, ohne dass die Konsequenzen weh tun.
Das ist der Reiz: Spieler fühlen sich mächtig, und wenn etwas schief geht, ist eigentlich nichts passiert. Gerade Jungs finden in den Spielen zudem Vorbilder, die es in ihrem realen Leben vielleicht nicht gibt – Männer, die zupacken und alle Probleme aus dem Weg räumen, und sei es mit Gewalt. Männer, die nicht jung und unsicher sind und die am Montag keine Mathearbeit schreiben müssen, ohne dass ihnen jemand dabei hilft, den Stoff zu verstehen.
Die Welt wirkt auf viele Jugendliche kompliziert
„Die Bindung dieser jungen Menschen an den Computer ist auch eine Antwort auf den asozialen Charakter unserer Gesellschaft“, sagt Bergmann, „sie sehnen sich nach der Geborgenheit einer sozialen Ordnung, und wir überfrachten sie mit einem irrwitzigen Leistungsanspruch, der über die Schulen vermittelt wird.“ Joseph Vogl fügt hinzu: „Die Welt wirkt auf viele Jugendliche kompliziert und unübersichtlich. Da helfen ihnen einfache Stereotype, Muster und Handlungsmodelle.“ Dass diese gerade aus Videospielen stammen, muss niemand gutheißen – die Frage ist jedoch, wie darauf reagiert wird. Je verworrener die Lage, desto einfacher die ersehnte Lösung: Das klingt eben auch wie eine Erklärung für den Dogmatismus in der Killerspieldebatte.
Bergmann folgt in seiner Argumentation keiner politischen Agenda. Mal sagt er, „Egoshooter sind als Bildwelten mit einer unerfreulicher Ästhetik versehen“, nur um hinzuzufügen, dass „ihr Wirkungsgrad jedoch heillos überschätzt wird.“ Denn vor einem verwahrt er sich: Schlichtheit in der Debatte. „Zu sagen, das Spielen von Ballerspielen führe unmittelbar zu Verrohung und Aggressivität, ist zu einfach.“ Ein „Killerspiel“ mache noch keinen Killer. Familie sei wichtig. Amokläufern fehle soziale Bindung. Darauf können sich mittlerweile alle Experten einigen.
Es gibt jedoch so viele Experten, die sich in so vielen Punkten widersprechen. Gerade Eltern, die Angst vor Spielen haben, sehnen sich nach jemandem, der sagt, wie es ist. Jemand, der kritisch und glaubwürdig ist. Doch die von allen anerkannte Koryphäe gibt es nicht, und diese Unsicherheit wiederum steigert noch die Angst vor dem, was im Jugendzimmer geschieht.
Brücken über den Graben
Es wäre gut, wenn alle Eltern so wären wie die Eltern von Lasse Oswald. Für ihn spielen „Killerspiele“ keine Rolle. Er ist acht Jahre alt und ein aufgeweckter Junge mit strohblondem Haar, der erst kürzlich eine Klasse übersprungen hat. Er hat zwei ältere Schwestern und wohnt in einem reetgedeckten Fachwerkhaus in Hamburg. Lasse interessiert sich für den HSV und für Videospiele, wie fast alle hier in seinem Alter.
„Jeder in seinem Freundeskreis besaß eine Playstation, nur er nicht“, erinnert sich seine Mutter Angela. Die 43-jährige Steuerberaterin arbeitet halbtags von zu Hause aus. „Immer wenn er zu Besuch bei Freunden war, wollte er sofort Playstation spielen. Für die anderen Kinder war das nichts Besonderes, sie hatten ja eine. Für ihn aber war der Reiz groß.“ Lasse hat so lange gequengelt, bis er endlich eine Playstation 2 geschenkt bekommen hat. Nun besitzt er sechs Spiele, darunter „Lego Batman“ und „Fifa 08“. Eine halbe Stunde pro Tag spielt er, länger darf er eigentlich nicht. „Manchmal ist es auch ein bisschen mehr“, sagt seine Mutter, „die Spielkonsole ist ja auch ein bequemer Babysitter.“
Lasses Eltern achten sogar darauf, was er spielt – und erscheinen damit wie die Musterfamilie aus dem Jugendschutz-Katalog. Denn es ist beileibe nicht selbstverständlich, dass sich Eltern für den Inhalt der Games interessieren, mit denen ihre Zöglinge so viel Zeit verbringen. Sie selbst zu spielen – so weit gehen nicht einmal die Oswalds. Sie fremdeln mit dem Medium. Vater Sven, 42, kann sich jedoch an seine drei Tage währende „Tetris“-Sucht erinnern. „Das war sehr exzessiv“, sagt er, „ich habe mich irgendwann zwingen müssen, damit aufzuhören.“
Er kann also die Sogwirkung einschätzen, die Spiele ausüben können. Doch „Tetris“ ist weder „Fifa“ noch „Lego Batman“, und schon gar nicht „Counter-Strike“. Er kann seinen Sohn beim Spielen beobachten, verstehen kann er dessen Begeisterung nicht. Durchlebt Lasse dabei einen kurzfristigen Adrenalinschub, zeitlich begrenzt wie eine Achterbahnfahrt? Oder machen die Spiele etwas mit ihm, das sich langfristig einbrennt? Väter wie Sven Oswald sind bei aller Distanz immerhin sensibel für das Thema. Der Graben ist vorhanden, aber er scheint nicht unüberwindbar.
Secondhand-Erfahrungen sind meinungsbildend und wertlos
Um den Brückenschlag bemüht sich zum Beispiel Jürgen Sleegers. Der 38-jährige Pädagoge betreibt Aufklärung in der Höhle des Löwen. Sleegers arbeitet für das „Spielraum“-Projekt in Köln. Zusammen mit anderen Trägern wie der Bundeszentrale für politische Bildung betreut er die „Eltern- Lan“. Sie findet bundesweit während der Spieltage der Computerspiele-Bundesliga statt und wird vor allem von Erziehungsberechtigten und Lehrern besucht.
Während in einer großen Halle die Kids auf riesigen Leinwänden „Warcraft“- und „Counter-Strike“-Partien verfolgen, setzen sich im Schnitt 20 bange Eltern und neugierige Pädagogen in einem separaten Bereich vor ein paar Monitore und machen ihre ersten Schritte in der virtuellen Welt. „Wir wollen das Gespräch zwischen Spielern und Nicht-Spielern fördern“, sagt Sleegers. „Erwachsene sollen Jugendliche fragen können, was sie in diese Welten zieht und was sie darin so lange hält.“
Als Gesprächsgrundlage sollen nicht die „Counter-Strike“-Spielszenen aus dem Fernsehen dienen, in denen der Off-Kommentar andeutet, man steige im Blutrausch über zerfetzte Leichen – und das aus gutem Grund: „Secondhand-Erfahrungen mit einem interaktiven Unterhaltungsmedium sind zwar meinungsbildend, aber wertlos“, sagt Sleegers.
Wissend ins Kinderzimmer
Als Appetizer dient den Anfängern das Rennspiel „Trackmania“. Die Bewegung in der Virtualität, die Orientierung auf dem Bildschirm, das Kausalitätsprinzip von Befehl und Aktion – all das muss sich den Gästen erst einmal erschließen. Doch kaum geht der Wettstreit um die besten Rundenzeiten los, wird den digitalen Neulingen schon die harte Realität vorgeführt: „Counter-Strike“.
„Viele sagen dann, die Aufmachung und der angestrebte Realismus seien überhaupt nicht ihr Ding“, berichtet Sleegers. „Trotzdem beginnen die meisten zu verstehen, was daran faszinieren kann. Und dass es nicht darum geht, jemanden auf bestialische Weise zu ermorden.“ Mit dem erworbenen Wissen geht es dann zurück in die Kinderzimmer und Schulklassen. Dann wird mit den Kindern über Spiele gesprochen – und das vielleicht zum ersten Mal:
„Viele stellen erstaunt fest, wie groß bei den Jugendlichen dann der Respekt und die Gesprächsbereitschaft ist, nur weil man sich die Mühe gemacht hat, diese Spiele näher unter die Lupe zu nehmen“, sagt Sleegers. „Lehrern wird auch zugestanden, die Spiele nicht zu mögen. Denn die Kids kannten bisher meist nur Erwachsene, die sich damit brüsteten, sie müssten sich so etwas nicht anschauen, um es abzulehnen.
Die Massenmedien reagieren
Dieser Reflex ist auch in den Massenmedien zu beobachten, deren Aufgabe es eigentlich wäre, aufzuklären und zu differenzieren. Bereits am Tag des Amoklaufs von Winnenden am 11. März wird zum Beispiel in der ARD-Talkshow „Hart, aber fair“ über „Killerspiele“ diskutiert, bevor es überhaupt ein Indiz dafür gibt, dass der Täter gespielt hat. Am 16. März veröffentlicht die „Süddeutsche Zeitung“ einen Artikel, der die steigende Nutzungsdauer von Computerspielen behandelt. Illustriert ist der Text mit Bildern aus dem nicht als besonders blutig bekannten „World Of Warcraft“, die Überschrift des Artikels lautet: „Gewaltorgien am Computer“.
Die Kritik an Fehlern in der Berichterstattung mag haarspalterisch erscheinen – im politischen Teil einer Zeitung oder bei der Rezension eines Kinofilms wären die groben Schnitzer jedoch undenkbar. Kein Autor würde dort zwei Filmgenres verwechseln – in der „Taz“ jedoch äußert sich ein Journalist über „World Of Warcraft“, beschreibt aber das Gameplay von „Warcraft“. Das Schlimme: Wer daran Kritik übt, ist sofort diskreditiert.
Am 19. März bezeichnet „Die Zeit“ auf der ersten Seite ihres Dossiers über die Geschichte von Amokläufen die Kritiker des umstrittenen Kriminologen Christian Pfeiffer als „Allianz der Abgestumpften“. Eine Woche darauf fordert sie eine „Kultur der Einmischung“ und legt Eltern nahe: „Wir müssen uns neben die Jugendlichen setzen und uns den ganzen Müll ansehen, den sie sich einverleiben und verbreiten, und wir müssen ihnen den Respekt entgegenbringen, ihnen zu sagen, dass es Müll ist.“
Zack! So einfach ist das
Das Ergebnis: Angst und Hysterie. Kaufhof entfernt nach Winnenden alle Spiele für Erwachsene aus seinem Sortiment. Der Pianist Lang Lang macht Schlagzeilen mit dem Versprechen, in Zukunft nur noch gewaltfreie Spiele zu spielen. Ein Schülernetzwerk im Internet wittert willkommene PR und verkündet, fortan keine Minderjährigen mehr aufnehmen zu wollen, die Egoshooter spielen. „Die Politik diskutiert – ein Schülernetzwerk reagiert – Zeichen gesetzt“, posaunt die Pressemitteilung. Zack! So einfach ist das.
Spieler bringt so etwas auf die Palme. Zugleich begeben sie sich wehleidig in Verteidigungsstellung und warten auf den ersten Schuss von der anderen Seite. Auch sie haben Angst. Angst davor, dass ihnen jemand ihr Lieblingsspielzeug wegnehmen könnte. Und so belauern sich beide Seiten seit Jahren, verschanzt hinter ihren jeweiligen Experten und Studien.
Angst ist kein guter Ratgeber. Verständnis würde helfen, den Graben zuzuschütten. Dann nämlich wäre endlich die Zeit gekommen, sachlich über Spiele zu diskutieren. In der Familie, in der Politik, in den Massenmedien. Dann wird es erst richtig interessant – schließlich gibt es an Videospielen so manches, was es wert wäre, kritisch besprochen zu werden.
Die kleinen roten Geister hat Alexander Scholz gebustet.
Erschienen in: GEE Magazin, Mai 2009