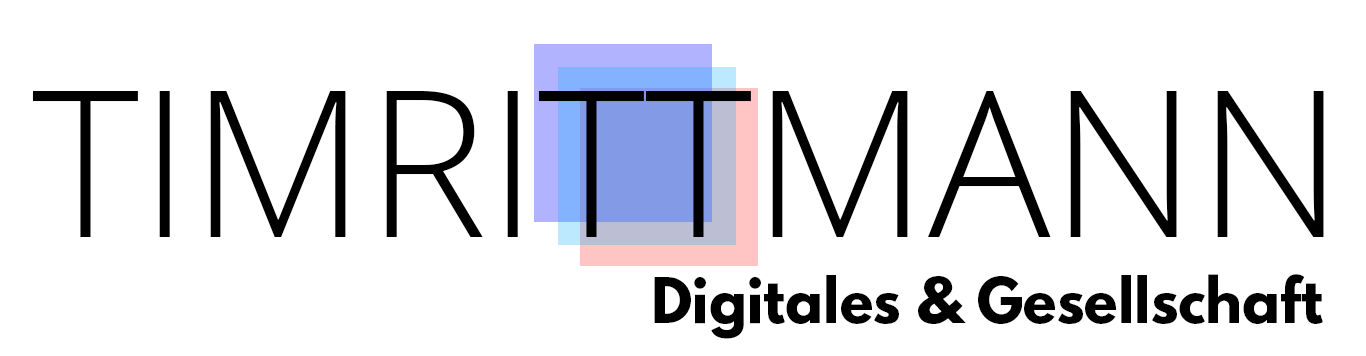„Tron“ war DER Film für die Generation Atari. Er markiert zugleich eine Zeitenwende zwischen analog und digital. Eine hohe Hürde für „Tron: Legacy“, das Vermächtnis an die Generation Xbox
Generation Atari und Generation Xbox – das soll vor allem gut klingen: kurz und knackig, so dass es in den Vorspann passt, neugierig macht und das Blut in Wallung bringt. Aber damit haben die Verallgemeinerungen auch ihren Zweck erfüllt. Legen wir sie nun beiseite. Was bleibt, ist die Sache mit der Generation. Einer Generation werden etwa 30 Jahre zugerechnet. Danach wird sie von der nächsten abgelöst.
Zwischen dem Erscheinen von „Tron“ und seinem Nachfolger „Tron: Legacy“ liegen 28 Jahre. Da wollen wir nicht kleinlich sein und behaupten: „Tron: Legacy“ IST das Vermächtnis an unsere Generation. Und die sitzt nun gespannt in weich gepolsterten Kinosesseln, hat 3D-Brillen auf der Nase, lässt sich eine Handvoll Popcorn schmecken und wartet, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Schließlich war der erste „Tron“ eine kleine Revolution und ist jetzt das, was man einen Kultfilm nennt.
Erst Reklame, dann Ikone
Es war 1982, als Disney endlich wieder einmal Mut bewies. Der Konzern mit der Maus sah bis dato seine Kernkompetenzen in Themenparks und zuckersüßen Folien-Zeichentrickfilmen und galt schon damals als ein wenig altbacken. Das änderte sich, als ein Typ namens Steven Lisberger die Disney-Zentrale betrat und das Skript zu „Tron“ vorlegte. Lisberger leitete ein Animationsstudio in Boston.
Er und sein Team kreierten dort Mitte der Siebziger ein Roboterwesen, das zwei Scheiben durch die Luft wirft und wieder auffängt. Das war Trons Geburtsstunde. Aber sie wussten damals nicht so recht, was sie mit dem Roboter anfangen sollten. Deswegen fristete er sein Dasein als animiertes Jingle für den Radiosender WOZ 94,5. Erst später machte Lisberger ihn zu etwas nie Dagewesenem. Der Roboter wurde zum Programm/User, die Diskus-Scheibe wurde zu einer Identity-Disc, die Idee zu einer Geschichte.
Es ist die Geschichte des Programmierers Kevin Flynn (Jeff Bridges), dessen digitalisierter Körper im Innenleben eines Computers gefangen genommen wird. In diesem Cyberspace – regiert von einer diktatorischen Zentraleinheit – sind die einzelnen Programme wie Menschen: Sie sprechen, laufen auf zwei Beinen und beten ihre User an, die sie für Götter halten. Das war alles etwas wirr, aber die Erzählung war nicht mehr als ein Vehikel für die Ästhetik. „Tron“ war vor allem technisch revolutionär.
Disney war sich bewusst, dass Teenager genauso gerne Münzen in Arcade- wie in Getränkeautomaten warfen. Auch der Heimkonsolenmarkt boomte. Allein vom Atari 2600 wurden etwa 30 Millionen Stück verkauft, und die Prophezeiung von IBM-Chef Thomas Watson, es werde weltweit niemals Bedarf für mehr als fünf Computer geben, hatte sich schon lange als ausgemachter Blödsinn erwiesen.
Der Cyberspace: gestern, heute, morgen
„Tron“ besaß das Potential, zum programmatischen Film dieser Generation Atari aufzusteigen. Knapp 15 Minuten Filmmaterial wurden ausschließlich computergeneriert. Das Verfahren war aufwendig, für die Berechnung von Animationen und Bewegungsverläufe gab es keine grafischen Interfaces. Noch aufwendiger allerdings war die restliche Machart des Films. Die Schauspieler agierten vor einem komplett schwarzen Hintergrund, was auch erklärt, warum ihre Darstellung teilweise etwas hölzern wirkt. Denn Blue- und Greenscreens wurden eher selten benutzt, und die meisten Schauspieler waren es gewohnt, eine Kulisse zur Hilfe zu nehmen, um sich in eine Situation besser hinein zu versetzen.
Doch für „Tron“ fügte die Special-Effect-Abteilung die umgebende Welt nachträglich mit einem komplizierten Fotografie-Verfahren namens Backlit hinzu. Das Ergebnis war ein Abbild des Wandels, ein Zwitter aus analogen und digitalen Bilderwelten. Darum ist „Tron“ ein visuelles Unikat, das neben den Romanen von Philip K. Dick und William Gibson unsere Vorstellung geprägt hat, wie der abstrakte Cyberspace als Raum aussehen würde.
Im Jahr 2010 haben wir, die Generation Xbox, eine weitaus genauere Vorstellung davon, wie der virtuelle Raum auszusehen hat. Wir wissen, dass er anders aussieht, dass er sein Aussehen unseren Wünschen anpasst. Wir brauchen keine Versinnbildlichungen mehr. Wir nennen ihn auch nicht mehr Cyberspace. Das klingt nach Apparaten, in die man sich erst mühsam einklinken muss, um die Illusion perfekt zu machen. Wir wissen, dass eine 3D-Brille dazu ausreicht. Sie ist unser neuestes Gimmick.
Glänzende Oberflächen
Auch „Tron: Legacy“ nutzt die digitale 3-D-Technik, und der Film tut es überzeugend. Er sieht einfach toll aus, eine blau schimmernde, antiseptisch wirkende Vision reinster Digitalität. Wir wissen heute, so sieht kein Computer von innen aus. Aber ein bisschen wünschen wir es uns. Das Schöne ist: Wir können uns ganz auf die glänzenden Oberflächen konzentrieren, werden nicht abgelenkt durch eine bemüht erzählte Geschichte. Wir haben dazugelernt, im Jahr 2010.
Dieses Mal ist es die Geschichte von Sam Flynn, Kevin Flynns Sohn. Sam ist ein junger Mann Ende zwanzig und Erbe eines Computer-Imperiums, das sein Vater ihm hinterließ, nachdem dieser in den Achtzigern spurlos verschwand. Aber Sam macht sich nichts aus dem Geld und der Verantwortung. Stattdessen sabotiert er die Geschäfte von Encom, der Firma, deren Mehrheitseigner er selbst ist.
Sein Vater war ein digitaler Pionier. Sam ist sein Update, freilich radikaler, denn um Pionierarbeit zu leisten, ist es zu spät. Als Alan Bradley (Bruce Boxleitner), seines Vaters bester Freund, von einer Nachricht des verschollenen Erzeugers berichtet, sucht Sam die alte Spielhalle auf, die einst seinem Vater gehörte. In einem versteckten Keller des vergessenen Gebäudes wird Sams Körper dematerialisiert und somit Teil eines Computerinnenlebens. Sam wird sofort von einer Art McAfee-Einsatztrupp aufgegriffen und muss gegen andere verurteilte Programme messen – als Gladiator, in Videospielen auf Leben und Tod.
Natürlich macht sich „Tron: Legacy“ seinen Vorgänger auch zum Vorbild, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Konturen der Welt treten wiederum als fluoreszierende Linien an den Anzügen der Figuren, den Gebäuden und den Raumschiffen hervor. Die Gladiatorenspiele bestehen abermals aus Diskuswerfen und Motorradrennen, und als ultimatives Transportmittel dient der zerbrechlich wirkende Solar Sailer – wie schon vor 28 Jahren.
Die Maskerade des Jeff Bridges
Als direktes Bindeglied zwischen den Achtzigern und dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, zwischen Atari und Xbox, dient die Figur Kevin Flynn, der eigentlich nur bei seinem Nachnamen gerufen wird (bei seinem Sohn ist es umgekehrt, er ist nur Sam). Dessen Gesicht, Flynns Gesicht, wurde auf den Körper des gealterten, echten Bridges gesetzt – und zwar mit derselben Technologie, die schon Brad Pitt in „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ in einen jungen Mann verwandelte.
Die Maskerade des jungen Bridges ist zwar manchmal etwas unheimlich – bei Videospielen spricht man vom „uncanny valley“ – , aber auch das ist glaubwürdig. Denn wer da aussieht wie der Flynn aus den Achtzigern, ist in Wirklichkeit Computer-Diktator Clu. Der ersann einst an Flynns Seite ein digitales Utopia, wandte sich danach aber in einem blasphemischen Akt gegen seinen Schöpfer.
Versuchte der erste „Tron“ das Innenleben des Computers zu erklären, in dem er seinen Einzelteilen Züge humanoiden Lebens verlieh, muss jetzt nichts mehr erklärt werden. Den meisten von uns sind die grundlegenden Prozesse eines Computers vertraut. Deswegen geht „Tron: Legacy“ mehr als nur einen Schritt weiter: Der Computer ist jetzt selbst Schöpfer von Leben.
Die ISO sind Wesen, die aus dem Nichts kamen. Nicht geschaffen von einem menschlichen User, dafür ausgestattet mit einem freien Willen. Kevin Flynn entdeckte sie als erster und bislang einziger Mensch. Sie sind sein Geheimnis, das er noch immer mit sich herumträgt. Und der alte Flynn lebt – sichtlich ergraut – immer noch, hat sich vor den Häschern von Clu im Niemandsland der Prozessoreinheit versteckt und fristet sein Dasein als eine Art Zen-Meister der Einsen und Nullen. Treu an seiner Seite: Quorra (Olivia Wilde), die letzte der ISO. Der Rest in einem Genozid gelöscht.
Sieht gut aus, klingt noch besser
Die Besonderheit der ISO soll der Geschichte eine gewisse Spiritualität verleihen, die ja so auch nicht wirklich mit Computerwelten in Verbindung gebracht wird und daher tatsächlich eine Neuerung darstellt. Aber weiter liegt uns der Film damit nicht in den Ohren.
Die sind eh damit beschäftigt, den grandiosen Sound und allem voran den Score des französischen House-Duos Daft Punk aufzunehmen. Die Soundkulisse reiht sich nahtlos in einen Film ein, der durch seine grandiosen Kulissen überzeugt. Davor agieren, weitaus vertrauter mit der Leere vor dem Special Effect, die Schauspieler.
Olivia Wilde als Quorra ist gut, mal stark, mal zerbrechlich, aber immer attraktiv. Michael Sheen als schillernder Zuse ist noch besser, ein Nachtclubbesitzer, der sich irgendwo zwischen den Geschlechtern bewegt wie David Bowie zu seinen besten Ziggy-Stardust-Zeiten. Über allem natürlich: der alte Jeff Bridges, einer der wohl konstantesten Hollywood-Darsteller der letzten 30 Jahre.
Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zum ersten Film. Denn dessen stilisiert dargestelltes Computerinnenleben war wohl ähnlich einflussreich wie „Matrix“. Und natürlich sieht auch „Tron: Legacy“ gut aus, objektiv vielleicht sogar besser, glatter, sauberer programmiert und designt: ein perfektes und zeitgemäßes Abbild dessen, was wir für digital halten.
Doch bei aller technischen Pracht ist der Film eines nicht: wirklich kreativ. Er zeigt uns nichts Neues, sondern toppt nur unsere Sehgewohnheiten. In einer ausführlichen Dokumentation über den ersten Tron erklärt der Conceptual Artist Roger Allers: „Es gibt Kreativität, und es gibt Technologie. Beide stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Aber Technologie ist nicht notwendigerweise kreativ.“ Das war in den Achtzigern genauso wahr wie heute.
Erschienen auf gamona.de