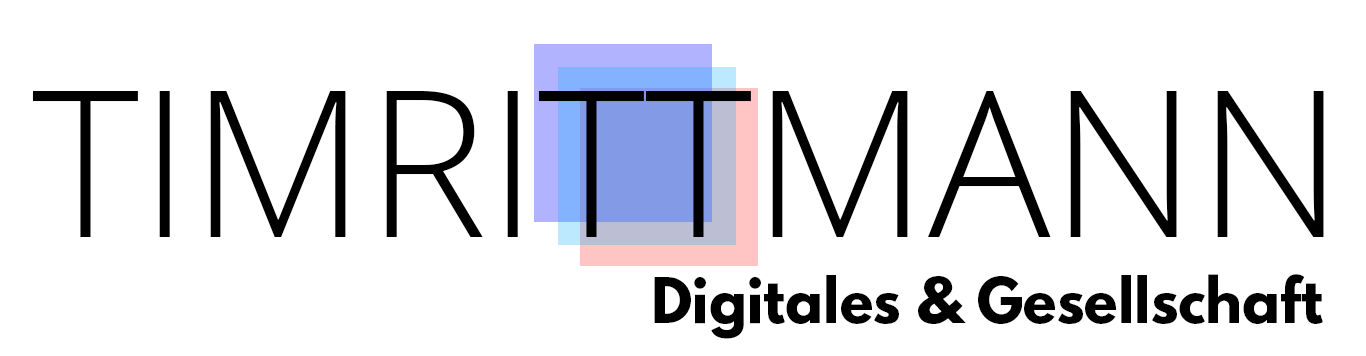Eine koreanische Comic-Verfilmung, eine spannende Ausgangslage: Science-Fiction-Western meets Theokratie meets Vampir-Bienenstaaten. Mehr kriegste nicht unter in einem Film. Aber das Sprichwort heißt nicht umsonst: „Viele Köche machen, dass der Brei kacke schmeckt.“
Da ist er wieder, der schöne Blutadel unter den Horrorgestalten, er trägt Rüschenhemden, riecht nach Mottenkugeln und Patchouli, sein Gesicht ist bleich von Anämie und Weltschmerz, hin- und hergerissen zwischen seinem Trieb und seiner Liebe zu der jungen Frau ist er die ideale Projektionsfläche für die Sehnsüchte von…nun ja, jungen Frauen.
Sucking Blood und Sucking Dick
Der Vampir ist der Posterboy der Untoten. Sicher, die Filmgeschichte hat genug ästhetische Ausreißer in petto, sehr frühe sogar; Murnaus Nosferatu (hinter dem Link verbirgt sich der ganze Film auf Youtube) ist auch irgendwie adelig, vor allem ist er jedoch ein Monster, nicht nur, wenn er seine Fangzähne zeigt, nein, er ist durch und durch ein Schreckgespenst. Wir sind ja daran gewöhnt – und zwar nicht erst seit „Twilight“ und „True Blood“ – dass Vampirismus immer auch eine schwüle Erotik innewohnt. Sucking blood und sucking dick, so groß ist der Unterschied nicht.
„Priest“ zeigt den Vampir von seiner Schattenseite. Nicht als einst menschlichen Ladykiller im Vintage-Look, angesteckt durch einen anderen Vampir, sondern als komplett andere Spezies. Bleich, geifernd, augenlos und unfähig zu sprechen, erinnert er eher an die nackten Mutanten aus „The Descent“. Ein Geschlecht wurde ausgespart, Testosteron versprüht er nicht. Er schläft in einem steinernen Sarkophag, dieser Tradition haben sich die Drehbuchautoren verpflichtet gefühlt, aber sonst ist er ein gefährlich aggressives und flinkes Herdentier, das in monumentalen Termitenhügeln haust.
Wie auch das Insekt ist dieser Vampir kein Einzelgänger, sondern berennt die Menschheit mit seinen Legionen, und das seit Ewigkeiten. „Es gibt Menschen und Vampire, so war es schon immer“, tönt die animierte Vorgeschichte, der Zuschauer erfährt, was es mit den Vampiren auf sich hat, dass sie stärker sind als Menschen und in vielen Kriegen nicht bezwungen werden konnte. Aha. Mehr erfährt der Zuschauer nicht, es ist banal und enttäuschend.
Priest sei Dank
Umgekehrt hat sich die Menschheit nur dank der Priester retten können, einer Sondereingreiftruppe, die von irgendwoher übermenschliche Fähigkeiten bekommen hat. Vielleicht war es ein besonders guter Drill-Sergeant, vielleicht war es der liebe Gott persönlich. Diesen Gedanken noch weiter auszuführen würde uns tief hinein führen in das Schreckensreich der Blasphemie.
Der Mensch hat sich nach dem Ende des Krieges zwischen Nacht und Tag in dunkle Städte zurückgezogen. Dort herrscht der Klerus und hält sich krampfhaft an seinem Unfehlbarkeitsanspruch fest. Draußen, außerhalb der Städte, fängt der Wilde Westen (!!!) an, wohnen bärtige Hinterwälder, hinterlistige Quacksalber und Sheriffs, die schnell mit dem Colt sind und ein hübsches Gesicht haben.
In einem Nebensatz wird erwähnt, dass die Kriegerkaste der Priester in der Zivilgesellschaft nicht zurecht käme. Man kennt das auch aus ernsteren Auseinandersetzungen mit dem Thema „Krieger kehrt heim“, sei es „Rambo I – First Blood“ oder „Die durch die Hölle gehen“. Der animierte Vorspann dauert wohl auch deswegen so lang, weil kein Genrestein auf dem anderen bleibt, weil nichts von dem, was uns als Kinogesetz gilt, in „Priest“ noch Gültigkeit besitzt, angefangen bei dem unerfreulichen Äußeren der Vampire, bis hin zu der Tatsache, dass sie sich im Steampunk-Western rumtreiben.
Wer gegen die Kirche spricht…
Nun macht nicht etwa der Kampf mit dem inneren Teufel Nutzlosigkeit dem Hauptdarsteller Paul Bettany als namenloser Priester zu schaffen. Die Rache treibt ihn an. Die Familie seines Bruder wurde von Vampiren überrannt, dessen Frau getötet, die Nichte gekidnappt, und die Kirchenoberen verharren derweil in Untätigkeit. Sie berufen sich darauf, es hätten keine Vampire sein können, der Krieg sei schließlich vorbei. Die fiesen Bestien hausen tatsächlich dank der Priester in ihren Reservaten, und wer gegen die Kirche spräche, würde auch gegen Gott sprechen. Es lebe die inhärente Logik. Es ist nur sympathisch und konsequent, dass der namenslose Priester seiner Glaubenseinrichtung den Rücken kehrt, gemeinsam mit Sheriff Hicks (Cam Gigandet) dem Vampirüberfall auf den Grund geht und einem Wesen entgegentreten muss, das weder Mensch noch Vampir ist. Mehr Konsequenz hat der Film leider nicht zu bieten.
Denn „Priest“ besitzt ziemlich genau drei starke Seiten. Ich möchte sie sehr genau beschreiben, damit mir keiner vorwerfe, ich hätte mir keine Mühe gegeben und würde nicht versuchen, dem Leser einen Gang ins Kino schmackhaft zu machen. Schließlich geht es den Kinobetreibern nicht so gut, da ist jeder Cent willkommen. Es würde mir und dem Kinogänger allerdings leichter fallen, wären die Filme im Großen und Ganzen besser.
Nach Vampirart
Der Film hat, mit viel Wohlwollen betrachtet, seine Stärken, etwa den haribobunten Genremix: Horror plus Western plus Science-Fiction plus düsterer Steampunk plus mittelalterlicher Kreuzzug, „Priest“ ist Frankensteins Monster unter den Vampirfilmen, zudem überladen mit Verweisen und überspitzt wie in einem Comic. Da spitzt man die Ohren und öffnet die Augen und freut sich über gelungene Einfälle wie Videobeichtautomaten und Vampirköniginnen. Und wen wundert’s: Die Vorlage ist ein gleichnamiger, freigeistiger Comic aus Korea (auch wenn in dem Comic überhaupt keine Vampire vorkommen).
Natürlich sehen richtige Vampire anders aus. Fans der Hammer-Filme, mit Christopher Lee als Dracula, werden mit ihnen nicht viel anfangen können, denn in „Priest“ sind die Vampire nicht mehr als Fratzen, denen hinterher das Label „Vampir“ angehaftet wurde, quasi als Orientierungshilfe für den Zuschauer. Würde man die strengen Vorschriften aus der Lebensmittelbranche auf die Entertainment-Industrie anwenden, Sony Pictures dürfte seine Blutsauger nicht als solche verkaufen, es wären „Monster nach Vampirart“. Vielleicht dürstet es die Welt aber nach neuen Vampirbildern. Als die Zombies in „28 Days Later“ laufen lernten, kam das ja auch einer Revolution gleich, die weithin begrüßt wurde. Und in Sachen Unkonventionalität kann der Herden-Vampir da durchaus mithalten.
Keine digitale Pappmaché
Zu einer weiteren starken Seite des Films: Er sieht gut aus. Nach der ansprechend animierten Eingangssequenz habe ich mich auf billige Effekte und Kulissen aus digitaler Pappmaché eingestellt. Bereits die dunkle Kathedralenstadt „City Five“ hat mich aber eines Besseren belehrt. Schwarze Ascheflocken regnen um die schwarzen Zinnen des mit hohen Türmen gespickten Molochs, während unten ebenso schwarze Soldaten patroullieren.
Die schroffe Wüste ist mit überdimensionalen Felslandschaften überzogen, die wir aus der Vogelperspektive betrachten dürfen, um auch den Einsatz der 3D-Technik zu rechtfertigen. Regisseur Scott Charles Stewart ist bislang auch eher als Spezialist für visuelle Effekte in Erscheinung getreten und hat unter anderem an „Mars Attacks“, „Sin City“ oder „Fluch der Karibik“ gearbeitet. Mit den Drehbüchern scheint er hingegen eher Pech gehabt zu haben. So auch hier.
Knietief im seichten Wasser
Die schiere Menge an Genres bringt viele gute Storyansätze in die Geschichte, die man hätte weiterverfolgen können. Neben dem oben schon erwähnten Anpassungsschwierigkeiten des Kriegsheimkehrers gäbe es Potential für ein Familiendrama, eine Geschichte über Freundschaft und Verrat, über den Kampf eines abtrünnigen Priesters gegen seine machthungrige Kirche, den eines unerfahrenen Vampirjäger-Novizen (Sheriff Hicks) oder einer verbotenen Liebe zwischen Priestern.
Aber der Film wird nur durch die gute Idee einer alternativen Welt (die aus der Comicvorlage) und das schnieke Aussehen zusammengehalten. Denn er schneidet unglaublich viele Themen an, bringt aber kein einziges auch nur einigermaßen zufriedenstellend zu Ende. Keines! Die Charaktere planschen knietief im seichten Wasser der Erzählung und bieten keinen Zentimeter zur Identifikation. „Priest“ ist weder spannend noch gruselig, und selbst einfache Schockmomente scheinen vergessen worden zu sein in dem Vorhaben, eine monumentale Geschichte anzureißen, die der aus 16 Bänden bestehenden Comic-Vorlage gerecht wird. Das Ende des Films lässt gleichzeitig so viele Fragen offen, man muss einfach davon ausgehen, dass mindestens ein Sequel eingeplant ist. Für Fortsetzungen braucht es allerdings einen guten Erstling.