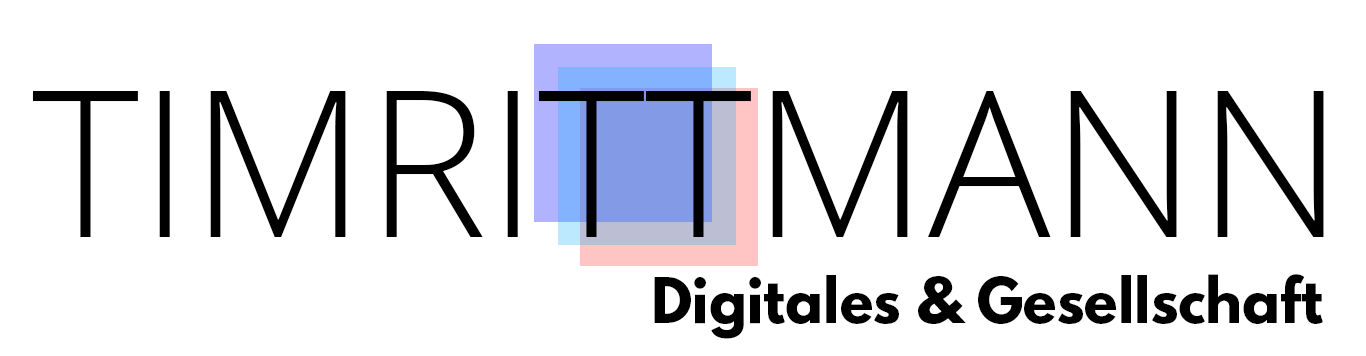Harper Reed war technischer Leiter von Obamas Wahlkampagne. Im Interview redet er über die heilende Kraft von Daten, transparente Überwachung und deutschen Datenschutz.
ZEIT ONLINE: Herr Reed, kennen Sie Peer Steinbrück?
Harper Reed: Nein, wer ist das?
ZEIT ONLINE: Er ist Kanzlerkandidat der Sozialdemokratischen Partei. Im September tritt er gegen Angela Merkel an, seine Umfragewerte sind momentan aber eher nicht so gut. Könnten ihn Big Data und Technik zum Kanzler machen?
Reed: Technologie ist manchmal wie eine leistungssteigernde Droge: Man muss bereits sehr gut sein. Technik kann nur dabei helfen, die entscheidenden fünf oder zehn Prozent besser zu werden. Und wenn dich keiner mag, kann auch die beste Technik deine Popularitätswerte nicht wesentlich steigern.
ZEIT ONLINE: Unpopulär war Barack Obama ja nicht gerade, als Sie anfingen, für ihn als technischer Leiter seines Wahlkampfteams zu arbeiten.
Reed: Nein, in den USA wollten die Menschen Barack Obama als Präsidenten.
ZEIT ONLINE: Wofür waren die Tools, die Sie und Ihr Team für die Kampagne „Organizing for America“ entwickelt haben, dann überhaupt gut?
Reed: Geholfen haben uns Tools wie Nahrwal vor allem im Umgang mit den Wechselwählern. Nahrwal ist eine Schnittstelle, die viele vorhandene Datensätze zusammenführt. Die Kampagnenhelfer hatten durch sie einen wesentlich leichteren Job. Zeit ist kostbar im Wahlkampf, und wir wollten sie nicht verschwenden, indem wir unsere freiwilligen Helfer an Türen überzeugter Romney-Unterstützer klopfen lassen. Wir wollten sicherstellen, dass wir mit Leuten reden, bei denen unsere Botschaft auch ankommt.
Durch die Tools haben die Wähler Obama nur noch mehr gemocht, als sie es ohnehin bereits taten.
ZEIT ONLINE: Es mag ein wenig rückständig klingen, aber in der deutschen Politik hat es bis zuletzt noch immer Stimmen gegeben, die sagten, das Internet sei für den Wahlkampf überschätzt.
Reed: Das sind Stimmen, die eher früher als später abgewählt und durch diejenigen ersetzt werden, die sich mit den wichtigen Kommunikationskanälen besser auskennen. Es gibt ein gutes Beispiel aus dem Geschäftsleben. Da wird oft gesagt, man wolle nun E-Marketing machen. Oder E-Business. Man stellt bestimmten Geschäftsbereichen einfach ein „E“ voran. Aber wir bewegen uns schnell auf eine Welt zu, in der jedes Marketing und jedes Business mit dem Internet verbunden ist.
Nicht, dass alles hundertprozentig über das Netz läuft. Das Netz ist nur ein Werkzeug. Aber zu sagen, das Netz sei überbewertet, ist in etwa, als würde ich behaupten, dass Fernsehen überbewertet sei.
ZEIT ONLINE: Aber nicht jeder Wähler nutzt das Internet, um sich zu informieren oder um mit seinen Freunden zu sprechen, oder?
Reed: Schauen Sie, ein gutes Beispiel ist das Hotel, in dem ich gerade untergebracht bin. Es ist ein sehr interessantes Hotel. In jedem Zimmer steht ein iMac anstatt eines Fernsehers. Auf den Straßen von Berlin habe ich gesehen, dass wahnsinnig viele Leute ein Smartphone besitzen. Das ist das Internet. Es ist ein Kanal, der vernünftig genutzt werden will, und wer ihn am besten nutzt, gewinnt.
Auch wenn Deutschland viele Gesetze zum Datenschutz hat, die ich lächerlich finde. Aber wer sich in diesem Gesetzesrahmen zu bewegen weiß und daraus etwas erschafft, wird erfolgreich sein.
ZEIT ONLINE: Neulich erschien in der ZEIT ein kontroverser Artikel über die Babyboomer-Generation. Darin stand, dass sie keinen Platz für die nachkommende Generation mache und dadurch viel Innovationspotential verschwendet werde. Sorgt das Netz für den ultimativen Clash der Generationen?
Reed: Wer die Macht hat, will sie nicht abgeben. Das gilt sicherlich für jede Generation. Aber die technologischen Veränderungen sind sehr drastisch. Wie erklärt man jemandem, der sein Handy höchstens für Telefonate und Textnachrichten benutzt, warum die Kids in den USA so sehr auf die Social Media App Snapchat abfahren? (Anmerkung: Snapchat ist eine App, mit der sich Fotos verschicken lassen, die nach wenigen Sekunden automatisch gelöscht werden.) Snapchat zeigt wie kaum etwas anderes die Unterschiede im Nutzungsverhalten zwischen Alt und Jung. Und mit den Alten meine ich bereits Mittdreißiger wie mich. Es sind revolutionäre Anzeichen, aber wie die Revolution aussehen wird, wissen wir noch nicht.
ZEIT ONLINE: Es wird also eine Revolution geben?
Reed: Möglicherweise werden wir es gar nicht mitbekommen, bis sie passiert. Viele dieser jungen Menschen werden Unternehmen gründen. Sie werden mit Daten und mit dem Netz interagieren. Vor allem wird ihr Verständnis von Privatsphäre ein vollkommen anderes sein. Ihr Bedürfnis, mit ihren Freunden zu interagieren, ist ein ganz anderes. Man muss sich nur einmal 15-Jährige anschauen. Sie dokumentieren jeden ihrer Schritte. Wie wird sich das niederschlagen, wenn sie erst im geschäftsfähigen Alter sind?
ZEIT ONLINE: Sie sprechen damit ein sensibles Thema an. In Deutschland können wir dem Datenschutz viel abgewinnen…
Reed: Ja, ich weiß, ihr liebt dieses Thema.
ZEIT ONLINE: Viele von uns wollen eben ihre Privatsphäre schützen, vor allem im Internet. Sie haben vorhin behauptet, das sei lächerlich. Was meinen Sie damit?
Reed: Ich weiß natürlich um den historischen Bezug, den viele Deutsche zu diesem Thema haben. Wir sitzen gerade im ehemaligen Ost-Berlin, und dieser Teil der Stadt hat eine turbulente Vergangenheit, was das Sammeln von Daten betrifft. Mir ist bewusst, dass ich da aus einer privilegierten Position heraus argumentiere. Trotzdem glaube ich, dass die ältere Generation stets ihre Werte auf die jüngere projiziert. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich die jungen Leuten darum kümmern. Das meine ich mit lächerlich.
ZEIT ONLINE: Glauben Sie wirklich, der nachrückenden Generation sei Datenschutz egal?
Reed: Wenn ich junge Leute dabei beobachte, wie sie mit ihren Daten und ihrer Datensicherheit umgehen, bin ich mir sicher, dass sie ganz genau wissen, was sie da tun und wofür die Daten benutzt werden. Sie haben ein gutes Verständnis davon, wie sie ihre Daten kontrollieren.
Nehmen wir Facebook. Facebook sammelt jede Menge Daten, hat aber auch eine Menge cooler Funktionen. Man bekommt viel für seine Daten. Es ist ein guter Tausch. Es ist durchaus richtig, dass viele Firmen gesammelte Daten missbrauchen. Und Deutschland hat eine sehr strikte Haltung, wenn es um Datenschutz geht. Ich persönlich mag es aber nicht, weil man mit Daten so viel anstellen kann.
ZEIT ONLINE: Glauben Sie denn, dass diese jungen Leute sich der Auswirkungen bewusst sind, wenn sie mit ihren Daten unvorsichtig umgehen?
Reed: Das ist doch wie über Rock’n’Roll oder über Tattoos zu diskutieren, oder über alles, was wir als Kultur adaptiert und dann später für gut befunden haben. Wer tätowiert ist, hat deswegen doch kaum noch Probleme, einen guten Job zu finden. Selbst wenn einem die Eltern stets das Gegenteil eingeredet haben. Und die Advokaten der Privatsphäre sind häufig alt. Junge Menschen haben in diesem Diskurs eher keine Stimme. Und wird sie doch einmal gehört, klingt sie eher gleichgültig und sagt „Was auch immer“. Es scheint für sie okay zu sein.
ZEIT ONLINE: Auch für Sie persönlich scheint es okay zu sein. Ein Blick auf Ihre Homepage zeigt, dass Sie sehr offen mit Ihren persönlichen Daten umgehen…
Reed: Ja, ich bin da sehr offensiv. Vielleicht bin ich, was die Auswirkungen betrifft, anderen gegenüber im Vorteil, weil ich Software nicht nur konsumiere, sondern selbst programmiere. Daher erkenne ich auch den Handel. Ich habe einen Facebook-Account, ich poste täglich mein Gewicht, und man kann mich sehr einfach erreichen.
ZEIT ONLINE: Machen Sie das, um auf irgendeine Weise davon zu profitieren? Oder macht es Ihnen Spaß?
Reed: Es macht mir einfach Spaß.
ZEIT ONLINE: Sie glauben also nicht, dass man mithilfe von bestimmten Anwendungen sein eigenes Leben optimieren kann, so wie es deren Betreiber gerne anpreisen?
Reed: Ich weiß nicht. Vielleicht werden manche Sachen durch mehr Daten besser. Ich glaube an ein besseres Leben durch Daten. Aber es gibt eben auch Hunderte von Beispielen, auf die das nicht zutrifft. So bin ich mir nicht sicher, ob mein Leben dadurch besser wird, dass ich mit 2.000 Menschen über Facebook vernetzt bin. Es macht es auch nicht schlechter. Aber wie viele von uns adden Menschen auf Facebook, die sie eigentlich gar nicht kennen, und plötzlich hat man diese Fake-Freunde.
ZEIT ONLINE: Gibt es denn etwas, was Sie nicht teilen würden, weil Sie es für zu privat halten?
Reed: Ich kann mir nichts vorstellen, das ich nicht auch sharen würde. Ich habe schon darüber nachgedacht, meine DNA hochzuladen. Damit sich alle die Daten ansehen und mit der Information herumspielen können. Ich finde das großartig. Vielleicht wird es in der Zukunft ein paar schlimme Leute geben, die schlimme Dinge mit dem Erbgut anderer machen. Vielleicht scannt aber auch jemand meine DNA auf Krebsrisiken und informiert mich früh genug, und ich überlebe. Ich bin da Optimist.
ZEIT ONLINE: Diese Mischung aus Verständnis und dem, was Sie als Gleichgültigkeit bezeichnen, findet sich im Gedanken der Post Privacy wieder. Erkennen Sie sich darin wieder?
Reed: Post Privacy bedeutet ja nicht, dass man keine Privatsphäre haben will. Aber gerade junge Menschen sind nicht überrascht darüber, dass Facebook ihre Daten verkauft. Sie tauschen ihre Daten und bekommen dafür etwa eine tolle Foto-App, oder sie können dafür mit ihren Freunden chatten. Okay, es gibt Werbeeinblendungen, aber wie gesagt: Es ist ein Tausch.
ZEIT ONLINE: Aber ist es nicht auch unheimlich, dass etwa Ihre Konsumgewohnheiten aufgezeichnet werden und sich anhand der Daten mutmaßen lässt, dass Ihre Freundin schwanger sein könnte?
Reed: Es gibt einen spannenden Artikel, in dem der Autor beschreibt, wie er Kataloge für Babyartikel zugesandt bekam, noch bevor er und seine Frau jemandem von ihrer Schwangerschaft erzählt hatten. Ein weiterer Artikel behandelt den US-Discounter Target. Der kann einschätzen, dass bei Konsumenten, die eine parfümfreie Lotion und dazu ein paar andere Produkte kaufen, ebenfalls höchstwahrscheinlich eine Schwangerschaft ins Haus steht. Ja, die können anhand deines Konsumverhaltens sagen, ob du schwanger bist. Und Facebook kann voraussagen, ob Du Dich von deinem Partner trennen wirst. Natürlich finde ich das gruselig. Aber ich finde es nicht notwendigerweise falsch.
ZEIT ONLINE: Glauben Sie, dass Datensammler strenger überwacht werden sollten, etwa durch staatliche Institutionen?
Reed: Was mir Kopfschmerzen bereitet ist, wenn Regierungen versuchen, das Internet zu kontrollieren. Es gibt so viele Freiheiten im Internet, und jede staatliche Einmischung würde diese Freiheit eingrenzen. Ein Teil dieser gewährten Freiheit ist die Freiheit, Scheiße zu bauen. Ein Teil dieser Freiheit liegt darin, neue Freiheiten zu erschaffen. Über neue Medien Informationen auf neue Art und Weise zu teilen.
Wenn es eine Sache gibt, die Regierungen immer wieder aufs Neue beweisen, so ist es, dass sie Technologien nicht wirklich verstehen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Aber trotzdem versuchen sie, ihre Überzeugungen mit Hilfe von Gesetzen auf die Technologien zu projizieren. Wäre etwa Facebook transparenter, wäre es sicherlich besser. Ich finde, so sollte auch die Gesetzgebung aussehen. Sie sollte gewährleisten, dass es Datentransparenz gibt. Anstatt Dateneinsicht zu limitieren, sollte man Daten freigeben.
ZEIT ONLINE: Gibt es ein Beispiel, in dem Sie strengen Datenschutz befürworten?
Reed: Ein Freund von mir arbeitet in der Stadtbibliothek von Chicago. Dort beschäftigt man sich damit, Stadtbibliotheken besser in die sozialen Netzwerke einzubringen. Buchempfehlungen sind die eine Idee. Und es erscheint logisch, zu teilen, welche Bücher man sich anschaut. Doch gleichzeitig sind Bibliotheken auch das erste Ziel, wenn man Dinge über Menschen herausfinden möchte. Wer eine Hexenjagd auf Kommunisten plant, könnte auf die Idee kommen, in die Bibliothek zu gehen und die Ausleih-Listen bestimmter Bücher zu durchleuchten. In den USA gibt es dafür eine sehr strenge Gesetzgebung. Und die Bibliotheken schützen die Privatsphäre ihrer Nutzer, indem sie keinem eine Listeneinsicht erlauben. In der Hinsicht bin ich sicherlich auf einer Linie, die vergleichbar ist mit der Linie deutscher Datenschutz-Verfechter. Denn wir sollten keine Informationspolizei erschaffen.
ZEIT ONLINE: Unser Innenminister Hans-Peter Friedrich hat nach den Attentaten von Boston mehr Videoüberwachung gefordert. Schließlich habe diese dazu geführt, dass die Attentäter aufgespürt werden konnten. Was halten Sie davon, öffentliche Plätze derart „transparent“ zu gestalten?
Reed: Der Bostoner Polizeichef hat neulich erklärt, die Gesichtserkennung im CCTV habe nicht wirklich dabei geholfen, die Bombenleger zu finden. Ich glaube nicht, dass mehr staatliche Überwachung hilfreich ist, sondern ich halte sie für sehr schlecht. Es sei denn, jedermann hätte Zugriff auf die Daten der Überwachungskameras und nicht nur die Behörden. Ein offener Zugriff auf offene Überwachung, das klingt lustig, das könnte Spaß machen, oder?