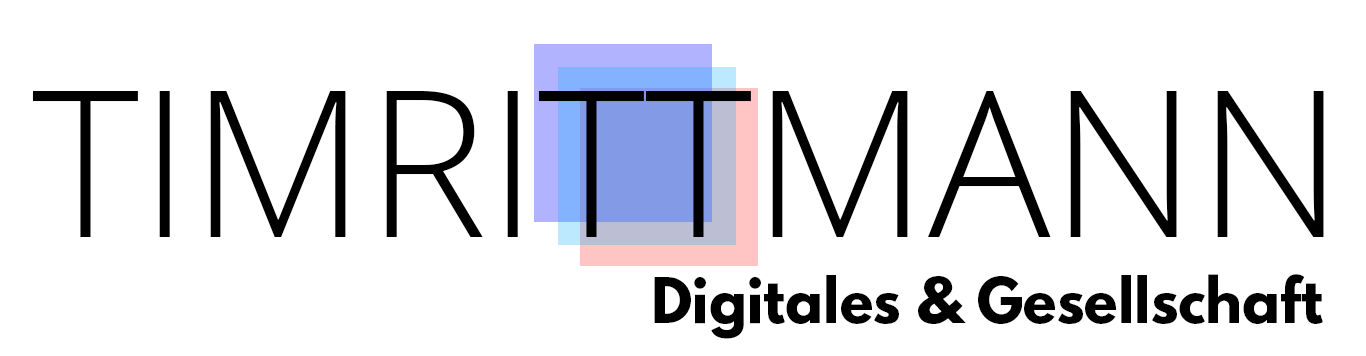Duncan Jones ist der Regisseur von „Source Code“ und der Sohn von David Bowie. Ich sprach mit ihm über seine Faszination für Berlin, den Ursprung seiner Kreativität und natürlich seinen neuen Film.
Man sieht es ihm ein wenig an. Duncan Jones ist der Sohn von David Bowie. Das Gesicht ist fülliger, und man weiß ja auch eigentlich nicht, wie Bowie so ist, die Kunstfigur, der Übervater. Aber wenn man sieht, wie sympathisch und fröhlich Jones, der Regisseur von „Source Code“, auf den ersten Blick ist, wird er sicherlich ein guter Übervater gewesen sein. Dafür spricht auch, dass er nicht in die musikalischen Fußstapfen seines alten Herren getreten ist, sondern als Hollywood-Regisseur nach „Moon“ nun mit „Source Code“ schon seinen zweiten Film abgedreht hat.
Hallo Herr Jones, wir haben gehört, sie möchten einen Science-Fiction-Film drehen, der in Berlin spielt.
Duncan Jones: Ja, das stimmt. Noch bevor die Dreharbeiten zu “Moon” begonnen haben, habe ich Sam Rockwell ein Skript für einen Film mit dem Namen „Mute“ geschickt. Dabei handelt es sich um den besagten Science-Fiction-Film, der in Berlin spielt. Den möchte ich irgendwann noch drehen. Denn ich habe hier gelebt, nur ganz kurz allerdings, in den späten Siebziger Jahren, und es war eine wirklich aufregende Zeit, aber gleichzeitig auch angsteinflößend. Es ist eine Erinnerung, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, diese Atmosphäre in Berlin.
Berlin und Science Fiction – zugegeben, das klingt für deutsche Ohren sehr eigenartig. Die Stadt ist ja nicht sehr futuristisch.
Duncan Jones: Ich bin neulich nach Berlin zurückgekehrt, um zu schauen, wie sich die Dinge da verändert haben. Und vor allem Ost-Berlin hat es mir angetan. So viele alte sozialistische Gebäude, die umfunktioniert wurden in Fitness-Center oder Nachklubs und Eigentumswohnungen. Ich dachte mir: Wenn sich die Stadt innerhalb von 15 Jahren derart schnell verwandelt, was passiert dann, wenn es diese Geschwindigkeit beibehält.
Berlin soll also deshalb Ort des Geschehens sein, weil sich die Stadt Hals über Kopf in eine neue Ära stürzt?
Duncan Jones: Exakt. Die Stadt ist für mich einer der aufregendsten Orte, um einen Science-Fiction-Film zu drehen. Wir sind schon für erste Vorbesprechungen in die Studios nach Babelsberg gegangen. Aber ich brauche zuerst Schauspieler, um dann durch sie und ihren Namen an Gelder zu gelangen.
Sie sagten gerade, Berlin sei damals angsteinflößend gewesen. Wie haben Sie das gemeint?
Duncan Jones: Als man in den Siebzigern nach Berlin flog, überquerte die von den Sowiets besetzten Gebiete, also Ostdeutschland. Wenn man landete, waren überall umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, die Mauer stand ja immer noch. Man bekam einfach das Gefühl, jeden Moment könne der Sturm der Sowjets losbrechen. Ich weiß nicht, an was Sie sich noch erinnern, aber ich weiß, wie paranoid ich bei dem Gedanken einer russischen Invasion war. Das Gefühl hatte ich ebenso in New York. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, wie viel Energie diese Stadt besaß, jeder Moment war sehr kostbar, denn man wusste nicht, was morgen sein würde. Daran erinnere ich mich. Und an den großen Weihnachtsbaum vom DaDeWe.
Ihr Vater, mit dem Sie damals in Berlin lebten, hat Sie sehr früh ins Kino mitgenommen, hat Ihnen Filme wie „Odyssee 2001“ gezeigt. Hat das einen großen Eindruck auf Sie hinterlassen?
Duncan Jones: Ja, er hat mir schon sehr früh Filme gezeigt, Filme wie Fritz Langs „Metropolis“, das deutsche Original des „Baron Münchhausen“, und natürlich „Star Wars“. Wir hatten zwei große U-Matic- Tapes von „Star Wars“, das waren die allerersten Videokassetten, die es gab, und ich habe die Filme so oft gesehen, bis das Band verschlissen war.
Woher stammt ihre Kreativität? Sind es die Gene?
Duncan Jones: Nein, es ist der Zucker! Zu viel Zucker. Scherz beiseite, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist nicht „nurture or nature“, also angeboren oder anerzogen, sondern beides gleichermaßen, „nurture and nature“. Ich denke, ich kann mich da glücklich schätzen. Mein Vater ist unzweifelhaft eine sehr kreative Person. Aber weil ich bei ihm aufgewachsen bin, war ich umgeben mit den Dingen, für die er sich leidenschaftlich begeisterte.
Wann darf ihr Vater sich ihre Filme anschauen?
Duncan Jones: Wenn ich es ihm erlaube. Er lebt in New York. Er geht dann inkognito, sitzt irgendwo unter den anderen Zuschauern. Wir haben das auch erst einmal gemacht, und zwar beim Sundance Festival, als „Moon“ aufgeführt wurde. Seine Reaktion war toll, weil er sehr nervös war, Angst, ja fast schon Panik hatte, genau wie ich. Und wir sind gemeinsam da durchgegangen. Dieses mal wird es wohl etwas anders für ihn, er hat die Kritiken gelesen, und die sind ja bislang alle ziemlich gut. Er kann also hineingehen, ohne allzu nervös zu sein.
Können Sie sich vorstellen, jemals mit ihm zusammen zu arbeiten?
Duncan Jones: Ja, mein Vater ist schließlich ein ganz hervorragender Schauspieler. Aber ich würde das erst machen, wenn ich genug Erfahrung gesammelt habe. Sagen wir, um einen gewissen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Noch fühle ich mich nicht so weit, ich muss noch ein paar Filme machen.
Wären sie eine gute Wahl, um sein Leben zu verfilmen?
Duncan Jones: Ich wäre sicherlich die schlechteste Wahl. Wahrscheinlich, weil meine Brille zu rosarot ist für einen objektiven und analytischen Blick auf sein Leben. Außerdem interessiere ich mich nicht wirklich für Musikfilme. Ja, ich bin nicht einmal ein besonders begeisterter Musikhörer. Man bräuchte da jemanden, der die Musik wirklich liebt.
Sie hören nicht einmal Musik, wenn Sie Dinge tun, wenn Sie Auto fahren?
Wenn ich arbeite, läuft im Hintergrund immer der Fernseher, entweder CNN oder Dokumentationen. Ich mag Nachrichten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich schätze Musik, ich erkenne sie, wenn ich sie höre, und ich arbeite mit Leuten, die mir dabei helfen, mich für die richtigen Sachen zu begeistern. Für „Mute“ habe ich eine ganz bestimmte Playlist, die ich für den Film haben möchte, es war Musik, die ich gehört habe, als ich am Drehbuch arbeitete. Aber im Großen und Ganzen höre ich mehr Nachrichten als alles andere.
Haben Sie sich mit „Source Code“ eigentlich auf das Genre Science-Fiction spezialisiert?
Duncan Jones: Ich hoffe, noch so ein oder zwei Science-Fiction-Filme machen zu können. Auch der nächste wird ein Zukunftsszenario, dann aber werde ich mal eine kleine Pause machen und versuchen, etwas anderes zu tun. Ich glaube, meine Fähigkeiten lassen sich überall einsetzen. Das klang jetzt gerade, als sei ich bei einem Bewerbungsgespräch. In Hollywood weiß man, dass ich gut mit Schauspielern arbeiten und sympathische Hauptfiguren erstellen kann. Dass ich generell gut mit meinen Figuren umgehen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die sich auf alle anderen Genres übertragen lässt. Ich bin nicht der Typ mit den Special-Effects. Das würde ich als Einschränkung empfinden.
Sehen Sie denn Parallelen zwischen „Source Code“ und „Moon“?
Duncan Jones: Jake Gyllenhaal hat mich mit dem Drehbuch in Berührung gebracht. Ich denke, er gab es mir, weil er ein großer Fan von „Moon“ ist. Und er hat bemerkt, dass es Parallelen in der Thematik gibt und ein Regisseur vor ähnliche Probleme bei der Inszenierung von klaustrophobischen Umgebungen gestellt wird. Als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich eigentlich eher an die Gelegenheit, die sich mir bot, einmal etwas komplett anderes zu machen. Denn es gibt mehr als nur einen Schauspieler, viele Special Effects, etwas Romantik, etwas Humor und Action, der Kern des Ganzen ist eine interessante Science-Fiction-Idee. Erst viel später, als wir den Film geschnitten haben, fielen mir die Parallelen zu „Moon“ auf. Es hat mich also wohl eher auf einer unterbewussten Ebene angesprochen.
Reicht es für Sie als Regisseur aus, ein Drehbuch zu lieben, um dann einen guten Film daraus zu machen? Oder müssen Sie sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen und Bücher wälzen?
Duncan Jones: Ich habe nicht viel recherchiert, auf jeden Fall habe ich meine Nase nicht zu tief in das Wissenschaftliche gesteckt, das Drehbuchautor Ben Ripley als Fundament der Geschichte benutzt hat. Mein Rüstzeug war mein generelles Interesse an Science Fiction sowie das bisschen Universitätswissen, das ich mir angeeignet habe. Aber ich fühlte mich auch nicht genötigt, diesem Kernaspekt, wie der Source Code in der Theorie funktioniert, mehr als nötig meinen Stempel aufzudrücken..
Wollen Sie eine Fortsetzung?
Duncan Jones: Lassen Sie es mich so formulieren. Ich erinnere mich, mit meinen Freunden damals eine Diskussion über Fortsetzungen geführt zu habem, nachdem wir den ersten Teil von „Matrix“ gesehen hatten. Sie freuten sich so sehr auf einen zweiten Teil, ich aber sagte: „Nein, das war’s! Alle guten Ideen sind hier in diesem Film“. Und ich glaube, ich lag damit verdammt richtig.
Source Code hat nicht viel gekostet, knapp 30 Millionen Dollar. Schränkt ein kleines Budget ein, oder wirkt es befreiend?
Duncan Jones: Es gehört nun einmal zu meinem Job, mit Budgets zu haushalten. Das ist sogar ein wichtiger Teil. Es gibt eine Menge talentierte Regisseure da draußen, die keinen ihrer Filme innerhalb des abgesprochenen Budgets haben produzieren können. Ich habe jetzt zwei Filme gemacht, und so lange die ihr Geld wieder einspielen, spricht es für mich. Ich sehe es als meine Verantwortung, den Film innerhalb der Budgetierung abzudrehen. Natürlich sieht man sich als Künstler, hofft darauf, das Kunst entsteht, aber man muss auch einen Job durchziehen.
erschienen auf brash.de