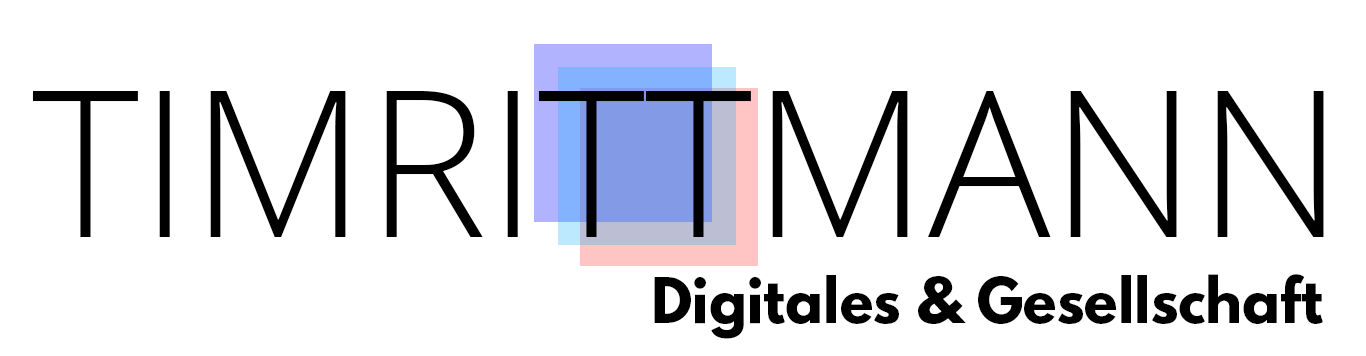Töten soll keinen Spaß machen
Der deutsche Shooter „Spec Ops: The Line“ will das Töten erschweren. Der Spieler soll sich angesichts des Wahnsinns des Krieges selbst hinterfragen – was funktioniert.

Für eine erste Ehrung kommt Spec Ops: The Line, das neue Computerspiel von Yager Development aus Berlin, knapp zwei Monate zu spät. Ende April wurde der deutsche Computerspielpreis für das beste Game 2012 an einen Egoshooter vergeben. Die Entscheidung sollte weniger die kulturelle Bedeutung des Spiels hervorheben, als vielmehr ein Zeichen gegen politisch motivierte Bevormundung setzen. Computerspiele sind schließlich auch Erwachsenenunterhaltung. Und die darf durchaus auch mal heftiger ausfallen.
Doch weil der Preisträger ein „Killerspiel“ Made in Germany war, führte das in der Politik sofort zu Debatten um den Preis selbst. Dabei war nicht das Spiel das Problem. Das auserkorene Crysis 2 ist unter rein technischen Gesichtspunkten durchaus preiswürdig. Das eigentliche Problem ist, dass es ihm hierzulande an Konkurrenz mangelt. In Deutschland werden große Actiongames praktisch nicht entwickelt. Bis jetzt.
Auch wenn die bloße Spielmechanik oder der Mehrspielermodus von Spec Ops: The Line nicht absolutes Topniveau erreichen, so glänzt der Shooter doch in einem Bereich, in dem viele andere massiv schwächeln: bei der Erzählweise. Spec Ops thematisiert Dinge, die bei anderen Genrevertretern zugunsten der leichteren Konsumierbarkeit gern ausgeblendet werden.
Referenzobjekt „Apokalypse Now“
Zugegeben, bereits eine nicht vollkommen unkritische Haltung zu Imperialismus und Krieg und bereits ein vages Hinterfragen des Gut-Böse-Schemas gilt bei Shootern als Alleinstellungsmerkmal. Und Spec Ops: The Line ist weiß Gott auch nicht subtil. Doch gelingt es ihm, den Spieler mit seinen Handlungen und mit den Folgen des Krieges zu konfrontieren.
Als Referenzobjekt diente den Machern deswegen auch kein Konkurrenzprodukt, sondern Francis Ford Coppolas Vietnam-Kriegs-Film Apocalypse Now. Ebenso wie dieser handelt auch Spec Ops: The Line von einer Reise in das Herz der Finsternis des Krieges und von der Frage nach dem Sinn des eigenen Tuns.
Captain Martin Walker soll mit zwei Kameraden in einem durch heftige Sandstürme verwüsteten Dubai nach Überlebenden suchen. Als Anhaltspunkt dient ein aufgefangenes Funksignal des einst mit Walker in Afghanistan dienenden Colonel Konrad. Dessen 33. Kompanie, die ursprünglich bei der Evakuierung der Stadt helfen sollte, hält in der prachtvollen Ruine die Stellung und ist in einen unübersichtlichen Kleinkrieg mit mindestens einer weiteren Partei verstrickt.
Die drei Soldaten glauben anfangs, bei einem notwendigen Einsatz zur Evakuierung zu helfen, entdecken jedoch nach und nach, dass es um ein Massaker an der Zivilbevölkerung geht.
Das bringt die Protagonisten nicht nur gegen den Urheber der Gewalt auf, sondern auch gegeneinander. Plötzlich meldet sich das Gewissen der virtuellen Kameraden und erhebt sie über den Status der stumpf schießenden Erfüllungsgehilfen des Spielers. Und nachdem dieser zu Beginn noch munter die sich ihm in den Weg stellenden Gegner liquidiert, fragt auch er sich bald, auf wen und warum er da eigentlich schießt. Ja, das schafft das Spiel tatsächlich: Der Spieler hinterfragt sich.
Eine Szene, die besonders anschaulich verdeutlicht, was Spec Ops: The Line anders macht als die Konkurrenz, ist ein Angriff mit Phosphorgranaten auf eine kleine Armee gegnerischer Truppen. Die Attacke lenkt der Spieler in Person von Captain Walker am Laptop, seine angespannten Gesichtszüge spiegeln sich auf dem Monitor; helle Punkte werden von dem noch helleren Aufflackern des Granatfeuers verschlungen.
Aber die danach folgende Szene, das Schlachtfeld, durch das uns die Kamera zwingt, gehört sicherlich zu den grausamsten und gleichzeitig eindrücklichsten Erlebnissen, die es in Computerspielen bislang zu sehen gab. Weil die Sprintfunktion an dieser Stelle des Spiels deaktiviert ist, wird der Soldat Walker langsamen Schrittes über ein mit verbrannten Gegnern übersätes Schlachtfeld geführt. Dort sucht man förmlich nach erbärmlich jammernden Gestalten, die noch erlöst werden können. Man will gutmachen, was nicht mehr gutzumachen ist. Die Botschaft kommt an.
„Der Spieler soll sich schlecht fühlen“
„Der Spieler soll sich schlecht fühlen“, sagt Jörg Friedrich, leitender Level-Designer bei Yager. Es ist ein Satz mit absolutem Seltenheitswert in einer Industrie, die sich den unbeschwerten Spielfluss auf die Fahnen geschrieben hat und bei der es normalerweise darum geht, immer neue Reihen von Gegnern so schnell und effizient wie möglich umzulegen.
„Teamintern hat das einen handfesten Streit verursacht“, sagt Friedrich. Streitpunkt war der Kontrollverlust des Spielers, der in manchen Abschnitten zum Hinsehen gezwungen wird, in anderen schnell handeln muss, obwohl die Lage moralisch absolut unübersichtlich ist. „Wird dem Spieler die Kontrolle aus der Hand genommen, und er soll etwas machen, wobei er sich nicht wohlfühlt, ist das eigentlich ein Anzeichen für schlechtes Gamedesign.“ Bei Yager ist es ein bewusstes Stilmittel.
Spec Ops: The Line sieht nicht ganz so gut aus wie andere Shooter mit Kriegshintergrund wie beispielsweise Battlefield. Trotzdem hat das Spiel seine Schauwerte. Die in gigantischen Dünen versandeten Hochhäuser, die plötzlich über die Spielfiguren hereinbrechenden Sandstürme und die absurden, weil in einer Stadt ohne Wasser wertlosen Insignien der Dekadenz machen Dubai zu einem abwechslungsreichen Dystopia – das man gerne freier erkunden würde, als das Spiel es zulässt.
Und es ist auch kein Egoshooter, sondern zeigt die Spielfiguren aus der Perspektive der dritten Person. Die Kamera schaut der Hauptfigur, die nach 48 Stunden Dubai reichlich mitgenommen aussieht, stets aus einigen Metern Höhe von hinten über die Schulter. Jörg Friedrich sagt, man habe keinen Egoshooter machen wollen. Denn da sei stets die Waffe der Protagonist.
erschienen bei Zeit.de